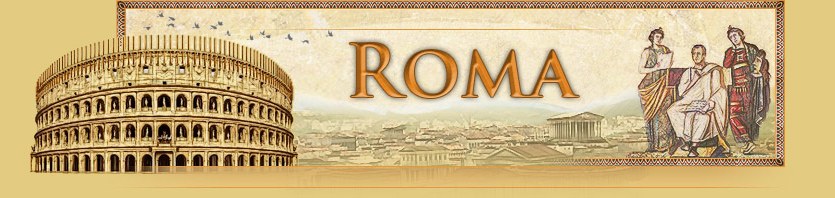No man is an island, entire of itself;
every man is a piece of the continent, a part of the main.
If a clod be washed away by the sea, Europe is the less,
as well as if a promontory were,
as well as if a manor of thy friend's or of thine own were.
Any man's death diminishes me because I am involved in mankind;
and therefore never send to know for whom the bell tolls;
it tolls for thee.
John Donne 1572-1631
An jenem Vormittag schickte die Wintersonne erste zaghafte Strahlen zur Erde, die durchaus als Vorboten für den herannahenden Frühling gedeutet werden konnten. Ein Zeichen dafür, das Brigid, die große strahlende Göttin schon bald die schwarze Morrigan vertreiben würde, so dass die Natur wieder erwachen und die ersten Lämmer wieder geboren werden konnten.
Bridhe genoss das wärmende Sonnenlicht, als sie hinaus trat. Einen Moment lang blieb sie stehen und hob ihr Gesicht zur Sonne. Herrlich, diese Wärme! Das Leben hatte sie wieder.
Der Junge hatte sich mit den Nachbarskindern zusammengetan, seinen Freunden. Sie spielten. Zufällig fiel sein Blick auf die Mutter. Er war ein wenig in Sorge, als seine Mutter das Haus verließ. Doch sie konnte ihn beruhigen. Sie wolle nur einige Besorgungen machen, sagte sie ihm und ging dann. Diarmuid sah ihr kurz nach, widmete sich dann wieder seinen Freunden und dem Spiel.
Es war wohl kein Zufall gewesen, als sie ihre Richtung änderte und nicht in die überfüllten Straßen einbog, die alle irgendwann zum Mercatus Traiani führten. Vielmehr wandte sie sie sich einer Straße zu, die sie vor einigen Nächten schon einmal gegangen war. Sie führte sie in die Nähe des Flusses, dessen Geruch keinen Zweifel übrig ließ. Davon ließ sie sich aber nicht beirren.
Unbeirrt führte sie ihr Weg zu diesem Platz, an dem sie vor wenigen Nächten zuvor gewesen war.
Bei Tage sah das Ufer ganz anders aus, als im Morgengrau. Viel lebhafter und weniger gespenstisch. Die Böschung war nicht zu steil gewesen, so dass man gut hinunter ans Ufer steigen konnte. An dieser Stelle floss der Fluss langsam. Das war nicht nur ihr Glück gewesen, auch das des Urbaners, der sich mutig in die Fluten geworfen hatte, um sie zu retten.
Gar nichts deutete mehr darauf hin, was hier wenige Nächte zuvor geschehen war. Alles erschien so friedlich und arglos. Nur in Bridhes Gedanken drehte sich noch alles um die Tat, die sie beinahe begangen hatte. Was war nur in sie gefahren, dass sie so verzweifelt gewesen war? So verzweifelt, dass sie selbst ihren Sohn zurück lassen wollte. Er war doch ihr Einziges! Das wertvollste, das sie besaß.
In ihrer Verzweiflung hatte sie tatsächlich geglaubt, das Flüstern Midirs des Sidhefürsten zu hören und war ihm gefolgt: Vielschöne Frau, du Kleinod von Erinn, komm in mein Wunderland, du Wonnereiche, wo goldgelockt die Glücklichen wandeln! Aus sanfter Dämmerung dunkler Wimpern strahlen die Augen der Edlen dir Heil.
Bridhe war zurückgekehrt, nicht nach Erínn, nicht an die Gestade ihrer Heimat. Sie war zu ihrem Sohn zurückgekehrt und hatte erkannt, dass sie so wenig ohne ihn sein konnte, wie er ohne sie. Doch mit dieser Erkenntnis war nicht auch ihre Sehnsucht besiegt worden. Diese würde sie immer mit sich tragen, gleich wo sie hin ging.
Vorerst verharrter sie am Ufer des Flusses und stellte sich vor, dies wäre der Fluss, an dessen Ufer sie als Kind gespielt hatte.
Reserviert! ![]()