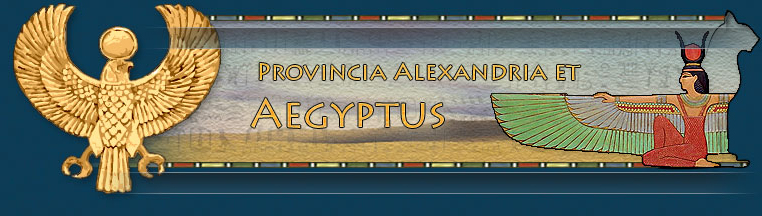„Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes,
Welcher so weit geirrt...“
- Homer, Odyssee
Weit jenseits der Grenzen von Aegyptus, im äußersten Süden des Reiches von Kusch
Dichte Schwärme von Insekten tanzen über der tiefgrünen Wasserfläche. Massen von Lotos und Wasserhyazinten bedecken die träge strömenden Fluten des Nils. Die Schwüle ist drückend, die Luft feucht wie in einer Waschküche. Mit lauten Surren schwankt eines der geflügelten Biester um Cethegus herum, lässt sich dann auf seinem Arm nieder. Zückt den Stachel, gierig nach seinem Blut. Unwahrscheinlich groß sind hier die Steckmücken, Dolchstiche scheinen ihre Bisse.
Er erschlägt das Insekt mit der flachen Hand. Es hat sich heute schon gelabt. Ein Blutfleck bleibt zurück auf dem weiten Ärmel seines meroischen Gewandes. Er ist dazu übergegangen ihre Kleidung zu tragen, während seiner Reise durch ihr Gebiet. Sie ist praktischer in diesem Klima.
Er tut einige Schritt am Ufer entlang und übersieht den Aufbau des Lagers zur Nacht. Angetrieben von seinen Wächtern mit den Nilpferdpeitschen ziehen die einheimischen Ruderer und Lastenträger die Dhau an Land, in der er zur Zeit unterwegs ist. Ein windiges Schiff, erbaut aus gebündeltem Schilfrohr, ohne einen einzigen Nagel. Kaum vertrauenserweckend scheint sie, und hat ihn doch schon unzählige Meilen den Strom hinaufgetragen. Den Nil, Urquell des Lebens. Zu seinen Quellen soll sein Weg ihn führen. Quell des Lebens, Quell der Unsterblichkeit.
Ein langgehegter Traum. Cethegus wird ihn verwirklichen. Die Quellen finden. Den Ursprung des Seins. Wie lange ist es her, dass er Alexandria verließ? Die Stadt die ihm zur Heimat geworden, die Freunde und Feste, die nahen Jagdgründe, die Abende glückstrunkener Seligkeit an den Gestaden des Mareotisees... Alles was er liebt hat er dort zurückgelassen. Gleichermassen alle Verstrickungen und Schulden.
Unermüdlich reist er den Strom hinauf. Treibt seine Leute zur Eile, gönnt sich keine Ruhe. Stromaufwärts immer stromaufwärts. Er wird sie finden, die Quellen. Muss sie finden. Im Rauschen des Stromes hört er ihren Ruf.
Die Sonne verglüht hinter den Wipfeln der Bäume. Als eine undurchdringliche Mauer säumen sie den Flusslauf. Stelen, Dickicht, Luftwurzeln, umrankt von Schlingpflanzen und fleischig duftenden Blüten, Gewucher, wimmelndes feindliches Leben. Dunkelheit breitet sich über das Land. Auf der schrägen Fläche des Ufers werden nun große Feuer entfacht. Der Qualm soll die Insekten fernhalten.
Weit ist Cethegus schon vorgedrungen. Fünf Katarakte liegen hinter ihm. Zum eintönigen Singsang der Träger ist er über ein Netz staubiger Steppenpfade gezogen, er verlor sich zwischen haushohen Bambuswäldern, überstand Entbehrungen und überlebte die Attacke eines erbosten Flußpferdes. Durch schnelle Flucht. Einen Angriff bizarr bemalter Stammeskrieger hat er dagegen mit seinen Wächtern abgewettert. Die Einheimischen hielten ihn wohl für einen Sklavenhändler.
In Meroe, der glänzenden Stadt von Gold und Elfenbein, wo man Rom keine Liebe entgegenbringt, gab er sich darum als ein Händler aus Punt aus. Genug dieser Sprache lernte er auf seiner zweiten Reise, als er auszog, die Edelsteine der Herrscherin von Saba zu finden. Leider war ihm damals kein Erfolg beschieden. Die Grabkammer enthielt nur ein paar mürbe Gebeine. Doch in der Stadt der tausend Wunder hielt ihn keiner auf. Er verweilte aber nicht lange in Meroe. Der Ruf der Quellen lockt ihn unablässig.
Die Zivilisation liegt nun weit hinter ihm. Nur hin und wieder stoßen sie noch auf einen Außenposten des Reiches von Kusch. Das Land ist Wildnis, tiefe Finsternis. Wälder, Nässe und Ungeziefer. Nachts dröhnen fern die Trommeln in den Wäldern. Sein Führer kennt sich nicht mehr aus, sein Dolmetscher versteht nicht die gemurmelten und geschnalzten Sprachen der Stämme. Kannibalen heißt es.
Oft hat Cethegus davon gehört, wie dieser Kontinent den Geist des Erforschers zermürbt, ihn unmerklich zerrüttet bis er zerbricht. Doch er ist ein Nachfahre der großen Kaiser. Weite und Fremdheit schreckt ihn nicht. Wohl spürt er die schwarzen Zungen der Raserei über seinen Geist hinwegflackern. Doch sie werden ihn nicht aufhalten. Er muss weiter.
In den Ruinen von Napata traf er einen abessinischen Reisenden, alt und sterbend, der ihm für eine Mahlzeit eine Legende erzählte. Von einem gewaltigen See im Herzen des Landes, inmitten unüberwindlicher Berge und undurchdringlicher Wälder. Paradiesische Schönheit, süßes klares Wasser in dem Fische wie leuchtende Juwelen schwimmen. Den wird er finden. Ihn auf einer Landkarte verzeichnen. Und natürlich wird er ihn nach ihr benennen.
Cethegus‘ Träger verstehen nicht den Sinn seiner Suche. Sie nennen ihn „Mzungu“.
Er hält das für eine Respektsbekundung. Sein Dolmetscher wagt nicht ihm zu sagen was es wirklich heißt: „Derjenige der herumirrt. Derjenige, der sich im Kreis dreht.“