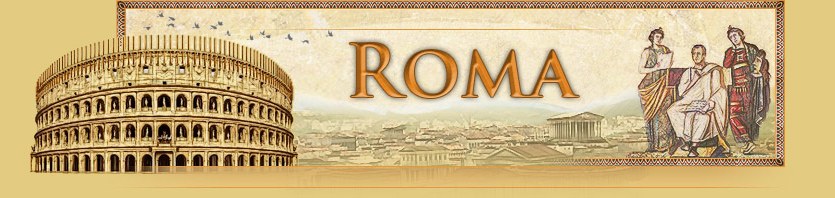»Es ist mir vollkommen egal!« schnauzte Menas den Sklaven an, der ihm beteuerte, dass seine Mutter derzeit nicht gesellschaftsfähig war. Er hatte sie schon ungeschminkt gesehen, da hatte dieser Germane noch wie ein Wilder auf einem Baum gehockt! Der Sklave protestierte nur noch kurz, dann schob Menas ihn einfach unsanft zur Seite und trat in die Gemächer seiner Mutter ein. Sie empfing ihn stets gern, warum also sollte ihn scheren, ob sie gut gekleidet und fein bemalt war? Dass sie jedoch nur ein dünnes Leibchen trug, verwirrte ihn, und schnell senkte er den Blick und wandte sich mit dem Rücken zu ihr. »Mutter.« Unterschwellig war diesem einen Wort Liebe zu entnehmen, und definitiv etwas wie Scham. Trotz ihres Alters war Casca noch eine der schönsten Frauen Roms, das fand zumindest ihr Sohn. »Ich habe Neuigkeiten«, fuhr er fort.
ARCHIV Die Seifenblase platzt. Oder: Träume werden wahr
- Marcus Artorius Menas
- Geschlossen
-
-
Die Valeria war gerade dabei gewesen, sich umzuziehen – sie achtete immer auf ihr Äußeres, auch wenn sie nur im Haus unterwegs war, aber es war doch noch einmal etwas anderes, in ihren Augen zumindest, wenn sie vorhatte sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Es mochten Kleinigkeiten sein. Aber es war ihr wichtig. Ihre Sklaven hatte sie hinaus geschickt. Auch das war ihr wichtig – Handgriffe selbst zu erledigen. Nicht immer und überall, verstand sich, aber so weit es Dinge wie Ankleiden betraf und sie die Zeit dazu hatte, machte sie das lieber selbst. Es ließ ihr die Illusion der Kontrolle. Sie wusste, dass es nur eine Illusion war, hatte sie doch schon vor langer Zeit die Erfahrung gemacht, dass so etwas wie Kontrolle nur in begrenztem Ausmaß ausgeübt werden konnte, gerade von einer Frau. Dennoch, oder gerade deswegen, erfreute sie sich an den Kleinigkeiten, die tatsächlich in ihrem Einflussbereich lagen – auch wenn sie bereits die Zeit kommen sah, in der jener ebenfalls kleiner werden würde, je älter der Körper wurde, den sie ihr eigen nannte. Aber noch war es weit bis dahin, wenn die Götter ihr gewogen waren – was zugegebenermaßen nicht immer der Fall gewesen war in ihrem Leben, aber deswegen gab sie noch lange nicht die Hoffnung auf.
Die Sklaven hatte sie also hinausgeschickt, im Vertrauen darauf, dass sie wussten, was zu tun war, um den Spaziergang vorzubereiten, und im Vertrauen darauf, dass sie mögliche unerwartete Besucher vertrösten würden – daher war sie überrascht, als die Tür schwungvoll aufging und ihr Sohn ihre Gemächer betrat, gerade als sie ihre Tunika abgelegt hatte und sich eine neue, aufwändigere hatte aussuchen wollen. Ihre Augenbrauen hoben sich etwas, aber sie kannte ihn – sie wusste, dass er sich von keinem Sklaven etwas sagen ließ. Dann huschte ein Schmunzeln über ihre Züge, als Marcus sich fast verschämt umdrehte, während das eine Wort, mit dem er sie begrüßte, ihr Herz wärmte. Das hatte es immer getan. Sie konnte sich noch heute an den Tag erinnern, an dem er zum ersten Mal Mama gesagt hatte zu ihr – tatsächlich gesagt, in dem Wissen, was es bedeutete, und nicht nur die Wiederholung einer simplen Silbe. Wie er sie dabei angesehen und gelacht hatte. Sie konnte sich daran erinnern, als wäre es erst gestern gewesen. Und bis heute liebte sie es, wenn er sie so ansprach. Mutter. Mit Marcus war ihr Wunsch in Erfüllung gegangen – nicht nur der Wunsch, ihrem Mann ein Kind, einen Sohn zu schenken, sondern der Wunsch nach einem Kind. Einem Kind, das lebte. Ruhig griff sie nach der Tunika, die sie eben noch getragen hatte und die nun über einem Sessel hing, um sie sich wieder anzuziehen, dann überbrückte sie die kurze Distanz zu ihrem Sohn. Sacht legte sie ihm die Hand auf die Schulter und drehte ihn zu sich, dann legte sie ihm eine Hand an die Wange und hauchte ihm einen Kuss auf die andere. "Marcus." Sie lächelte ihn an und trat einen Schritt zurück. Ihr Tonfall war liebevoll und leicht, beschwingt, und die Freude, dass ihr Sohn vorbei gekommen war, war deutlich zu hören. "Es ist schön, dich zu sehen. Von welchen Neuigkeiten sprichst du? Ich hoffe, es sind gute."
-
Menas, der sich ein wenig unwohl fühlte, stand eine ganze Weile an Ort und Stelle, betrachtete die Ornamente an der Wand und lauschte dem leisen Rascheln von Stoff. Als er die Hand seiner Mutter auf seiner Schulter spürte, wandte er sich bereitwillig um und sog ihren Duft ein. Eine Mischung aus Rosenduft und herbem Lavendel umgab sie, wie immer, und schlagartig fiel die Anspannung von ihm ab. Jeden anderen hätte er zurecht gewiesen, wenn er ihn so behandelt hätte wie seine Mutter es tat. Er wusste, warum sie ihn so sehr liebte wie sie es tat, doch war er klug genug, es nie zu erwähnen, wenn sie in der Nähe war. Selbst heute noch brach sie dann bisweilen in Tränen aus. Sein Vater war selten so taktvoll wie Menas. Vielleicht lag ihm auch nur nicht so viel daran, seine Ehefrau nicht aufzuwühlen.
Menas hob einen Mundwinkel und lächelte flüchtig, dann löste er sich in einer fließenden Bewegung von ihr und steuerte das halbhohe Fenster an. Direkt davor wandte er sich um und sah Casca an, die im roten Licht der Abenddämmerung nicht so reif aussah, wie sie war. Für Menas würde seine Mutter stets eine Schönheit bleiben. Auch mit grauem Haar und faltiger Haut wäre sie noch bewundernswert. »Vater hat es erlaubt«, sagte er nun mit von Stolz geschwängerter Stimme. »Endlich! Ich werde gleich morgen aufbrechen und mich einschreiben.« Menas breitete die Arme aus und strahlte seine Mutter an. Sie würde es wohl kaum gut heißen, doch er wäre ja nicht aus der Welt. »Ich gehe zu den Stadtkohorten. Dann kann ich dich immer besuchen«, beeilte er sich, zu sagen.
-
Marcus erwiderte ihr Lächeln, entfernte sich dann von ihr, um sich vor das Fenster zu stellen. Im Gegenlicht der Abendsonne konnte erschienen seine Gesichtszüge ihr verdunkelt, dennoch erkannte sie den Stolz, der in seinen Augen aufblitzte. Er verlässt mich, blitzte es durch ihren Kopf, den Bruchteil eines Augenblicks, bevor Marcus zu sprechen begann. Ihr Herz zog sich zusammen, begriff sie doch schon bei seinen ersten Worten, was sie bedeuteten. Sie musste ihren Sohn nicht so gut kennen, wie sie es tat, um zu wissen wovon er sprach – war doch das, was er meinte, bereits seit Jahren ein Thema. Immer hatte er zur Legion gewollt, und obwohl sie stets die Hoffnung genährt hatte, er möge sich im Zuge des Erwachsenwerdens anders besinnen, hatte sie doch gleichzeitig nie etwas anderes getan, als ihn ernst zu nehmen. Es hatte für sie keinen Unterschied gemacht, ob Marcus als Fünfjähriger vor ihr gestanden hatte oder als Fünfzehnjähriger. Sie hatte seine Wünsche nie als die Hirngespinste oder Träumereien eines Kindes abgetan. Sie hatte ihn immer ernst genommen.
Und jetzt würde er gehen. Was für einen Aufstand hatte es gegeben, als Tiberius sich geweigert hatte, ihrem Sohn die Erlaubnis zu geben, am Krieg gegen die Parther teilzunehmen! Und obwohl sie stets zu Marcus gehalten hatte, hatte sie ihm in diesem einen Punkt ihre Unterstützung verweigert. Sie hätte es nicht ausgehalten, ihn zu verlieren. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie die Angst ausgehalten hätte, die sie um ihn gehabt hätte, wäre er in den Krieg gezogen. Sie hatte sich zurückgehalten, bei dem Streit – sie äußerte ihre Meinung stets zurückhaltend, selbst wenn sie mit ihrem Mann allein war. Marcus hatte ihr verziehen, so hoffte sie, dass sie ihn in diesem Fall nicht unterstützt hatte, ihn nicht hatte unterstützen können – aber sie vermutete, dass es so war. Er wusste, wie viel er ihr bedeutete. Er wusste auch, worin dies, teilweise wenigstens, begründet lag. Und er hatte es nie ausgenutzt. Sie konnte nur ahnen, gemessen an der Dringlichkeit seines Wunsches, beim Militär zu dienen, die bis heute nicht abgenommen hatte, wie sehr er sich hatte zusammenreißen müssen, um sie nicht um Fürsprache zu bitten – hätte er das getan, sie hätte nicht gewusst, ob sie ihm diesen Wunsch hätte abschlagen können, auch wenn ihr Herz dabei geblutet hätte. Aber er hatte sie nicht gebeten, hatte sie nicht gezwungen, sich zu entscheiden. Und er war hier geblieben, voller Zorn. Sie hatte gewusst, schon damals, dass der Tag kommen würde, an dem Tiberius ihm nicht mehr würde verweigern können zu tun, was er wollte, aber sie hatte es verdrängt. Und nun war es soweit.
Für Momente stand sie da und musterte Marcus, während seine Worte zu ihr durchdrangen und Erinnerungen durch ihren Geist zogen. Ihr Herz wurde schwer. Ihr Sohn. Ihr Junge. Aber sie wusste auch, dass er nicht mehr der kleine Junge war, den sie beschützen konnte. Und die Stadtkohorten waren immerhin nicht die Legion. Er würde in Rom bleiben. Und er würde nicht kämpfen müssen, wenn es einen neuen Krieg gab… Sie zwang sich zu einem Lächeln, das eine seltsame Mischung war aus Trauer, die sie nicht zeigen wollte, und Freude, weil es sein Wunsch war, der nun in Erfüllung ging, nach so langer Zeit. Und sie freute sich aufrichtig, solange sie an ihn dachte, was es ihm und für ihn bedeutete, und nicht daran, was ihm zustoßen könnte, und erst recht nicht daran, dass er gefährdeter war als andere seines Alters. Und sie empfand auch Stolz, dass er hartnäckig geblieben war und sich durchgesetzt hatte, dass er sich durch seine Krankheit nicht abhalten ließ, zu tun was er wollte. Mehr und mehr versuchte sie, die negativen Gefühle zurückzudrängen, um sich mit ihm freuen zu können. Etwas anderes hatte Marcus nicht verdient. "Das sind wirklich gute Neuigkeiten." Sie trat wieder näher zu ihm. Zögerte einen Moment. Er hatte verdient, dass sie sich für ihn freute, aber er verdiente auch die Wahrheit. "Du weißt… wie ich darüber denke. Aber ich möchte, dass du weißt, wie sehr ich mich für dich freue. Das ist schon so lange dein Wunsch, und du hast ihn nie aufgegeben… Ich bin stolz auf dich." Sie wies auf die kleine Sitzgruppe in der Nähe des Fensters, wo auch Getränke bereit standen. "Darauf sollten wir anstoßen, meinst du nicht?"
-
Cascas Miene, die zuerst mehr schmerzlich als erfreut war, wandelte sich allmählich in wirkliche Freude, auch wenn sie die Trauer nicht ganz verbergen konnte. Dazu kannte Menas sie schlichtweg zu gut. Die Bestätigung aus ihrem Munde, dass es wahrhaftig gute Neuigkeiten waren, ließ Menas sich über ihr Zögern hinwegsetzen, und er nahm seine Mutter fest in die Arme, wenn auch nur kurz. Es war Balsam für sein Ego, dass sie ihrem Stolz so Ausdruck verlieh. Menas konnte ein zufriedenes Grinsen nur deswegen verbergen, weil er in ihr Haar grinste. »Das sollten wir wirklich«, sagte er und ließ sie wieder los, um sich in einen Sessel fallen zu lassen.
»Hast du schon mit Avitus gesprochen? Er ist jetzt in Rom stationiert, bei den Prätorianern«, erzählte Menas und überließ es seiner Mutter, für Getränke zu sorgen. »Er wird auf dich aufpassen, wenn ich nicht da bin. Vater wird vermutlich so schnell nicht nach Rom kommen.« Menas verzog das Gesicht und zuckte mit den Schultern. Dann griff er nach dem Becher, den seine Mutter ihm hin hielt. »Aber versprich mir, dass du nichts Gefährliches unternimmst. Und dass du mich auf dem Laufenden hältst. In der ersten zeit hab ich wahrscheinlich keinen Ausgang. Aber dann... Dann komme ich dich besuchen, so oft es geht«, sagte er mit vom Becher abgespreiztem Zeigefinger.
-
Die Trauer verschwand wenigstens für Momente gänzlich, als Marcus sie in den Arm nahm. Ihre Augen strahlten, unsichtbar für ihren Sohn, während sie dessen Umarmung erwiderte und leicht mit einer Hand über sein Haar fuhr. Am liebsten wäre sie noch länger in dieser Haltung verharrt, hätte sich noch länger von ihm halten lassen, so wie sie ihn all die Jahre gehalten hatte… Aber um nichts in der Welt wollte sie, dass bei ihrem Sohn der Gedanke aufkam, sie wäre zu anhänglich. Um nichts in der Welt wollte sie ihm zur Last fallen. Also lösten sich ihre Arme, kaum dass sie das geringste Anzeichen dafür wahrgenommen hatte, dass Marcus die Umarmung beenden wollte.
Immer noch lächelnd beobachtete sie ihn dabei, wie er sich in einen der Sessel fallen ließ. Für sie war ihr Sohn seit jeher die Anmut in Person, Anmut, so weit dieses Wort auf einen Mann überhaupt anwendbar. Es war schlicht seine Art sich zu bewegen, die schon immer von großer, wenn auch in frühen Jahren unbewusster Körperbeherrschung gesprochen hatte. Vielleicht hatte er das von ihr übernommen, der Körperbeherrschung ebenfalls so wichtig war – stets in voller Kontrolle über sich selbst zu sein, jede Geste gezielt zu setzen, keine überflüssigen zu machen. Jede ihrer Bewegungen, sei sie auch noch so klein, machte den Eindruck als sei sie genau so gewollt gewesen von ihr. Ob nun von ihr oder nicht, Marcus nannte diese Eigenschaft ebenfalls sein eigen, schon seit er ein Kind war, so zumindest ihre Sichtweise. In den letzten Jahren hatte sich jedoch einiges verändert. Er hatte trainiert, lange und hart, das wusste sie, und dieses Training hatte sich ausgezahlt. Seine Körberbeherrschung war bewusster geworden, und das machte etwas aus – in der Tat war es sogar ein großer Unterschied, ob eine Geste unbewusst gewollt wirkte oder tatsächlich gezielt eingesetzt wurde. Und die gewisse Lässigkeit, kombiniert mit Eleganz, die schon seit längerem immer mal wieder zum Vorschein gekommen war, schien nun dauerhaft aus seiner Haltung zu sprechen. Aber vielleicht waren es auch nur ihre Augen, die das so sahen, die sicher nicht die objektivsten waren.
Sie ging ebenfalls hinüber zu der Sitzgruppe, schenkte zwei Becher Wein ein – unverdünnt, das gebot schon allein der Anlass, selbst wenn es nicht Abend gewesen wäre –, reichte einen davon ihrem Sohn und setzte sich dann ebenfalls. "Nein, Avitus habe ich noch nicht getroffen." Erneut flog ein Lächeln über ihr Gesicht, halb stolz, halb gerührt, dass er sich derart Sorgen um sie machte. "Ich bin mir sicher, dass er sich um mich kümmern wird." Zu den Worten über seinen Vater schwieg sie. Sie wusste, wie er zu ihm stand – und sie war nicht begeistert darüber. Familiäre Probleme dieser Art ließen sich kaum lösen, aber sie würde sich wünschen, Marcus würde die Abneigung, die er gegen seinen Vater hegte, nicht zu deutlich zeigen. Tiberius war ihr Mann und sein Vater. Es hatte Schwierigkeiten gegeben, aber diese mussten nicht nach außen getragen werden, nicht einmal im kleinsten Kreis. Also schwieg sie, nur um dann schmunzelnd auf seine nächsten Worte einzugehen. "Etwas Gefährliches? Marcus, du kennst mich. Das mit Abstand Gefährlichste, was ich in letzter Zeit unternommen habe, war eine Bootsfahrt auf dem Tiber. Aber ich werde dir schreiben, solange du keinen Ausgang hast – und wenn ich der Meinung bin, dass du mich zu selten besuchst, werde ich das auch weiter tun." Wieder ein Lächeln, ein neckisches diesmal, dass sie plötzlich um Jahre jünger wirken ließ. Dann hob sie ihren Becher, um mit ihm anzustoßen. "Auf dich, Marcus. Und auf deine Träume, von denen einer nun in Erfüllung gegangen ist. Du hast es dir wirklich verdient."
-
Menas war sich da auch sicher, aber es würde nichts schaden, seinen Onkel noch einmal explizit darum zu bitten, dass er ein Auge auf Casca hatte. Ein feines Kräuseln überzog seine Lippen, die eine Braue wölbte sich um eine Nuance, doch sagte Menas nichts zu ihrer Bemerkung mit der Bootsfahrt auf dem Tiber. Er kannte sie gut genug, um törichte Dummheiten bei ihr auszuschließen. Andererseits hörte er sie so manche Nacht weinen, wenn sie dachte, sie sei allein. Allein die Götter wussten, wie sie sich erst fühlen musste, wenn er zu den Kohorten ging und das Haus noch einmal etwas leerer geworden war. Schon jetzt hielt sich kaum einmal jemand hier auf. Seine Mutter mochte auf diese Weise ohne weiteres an Einsamkeit krepieren. Doch das wollte er verhindern.
»Auf das Militär und all jene Tapferen, die ihr Leben für den Kaiser zu geben bereit sind«, erwiderte er im Gegenzug, als er seinen Becher um eine Winzigkeit empor gehoben hatte. Der Wein kratzte im Hals, doch Menas zwang sich, den Becher bis mindestens zur Hälfte zu leeren, ehe er ihn absetzte. Nach all den Jahren konnte er sich immer noch nicht recht für Wein begeistern, was jedoch nicht hieß, dass er ihn nicht trank. Das gehörte nun einmal zum Leben dazu, und wenn er von seinen späteren Kameraden akzeptiert werden wollte, musste er auch in saure Äpfel beißen können. Menas stellte den Becher fort und warf erneut ein Auge auf seine Mutter. »Du musst dir endlich jemanden suchen, Mutter«, konstatierte Menas dann vollkommen ernst und ließ Casca im Unklaren darüber, was genau er mit jemandem meinte.
-
Hätte Casca geahnt, welcher Art die Sorgen waren, die ihr Sohn sich um sie machte, sie wäre erschrocken gewesen – erschrocken darüber, dass wie viel mehr sie scheinbar offenbarte. Sie war mit Sicherheit nicht der Auffassung, dass sie an Einsamkeit zugrunde gehen würde. Aber dass sie einsam war, konnte sie nicht bestreiten, nicht wenn sie ehrlich war. Nur war sie der Meinung, diese Tatsache, wie so viele andere, tief in sich verschlossen zu haben, so tief, dass niemand etwas davon bemerkte, und wie so viele Mütter war sie der Auffassung, dass ihr das auch bei ihrem Sohn gelungen war. Sie hätte sich Vorwürfe gemacht, hätte sie gewusst, dass dem nicht so war.
Sie wusste allerdings nichts davon, und sie erwiderte nur sein angedeutetes Schmunzeln, hob ebenfalls ihren Becher und trank dann einen Schluck Wein. Nur ihrer Beherrschung hatte sie es zu verdanken, dass sie bei seinem Trinkspruch nicht zusammenzuckte, und sie verkniff sich ebenfalls den Kommentar, dass sie die Götter anflehen würde, dass ihr Sohn niemals in die Situation geriet, in der er die Bereitschaft, sein Leben zu geben, tatsächlich unter Beweis stellen musste. Bei seinen anschließenden Worten allerdings konnte sie ihre Überraschung nicht verbergen. "Ich muss was?" Verständnislos sah sie ihn an. Sie kannte Marcus so gut, aber in diesem Moment wusste sie nicht in seinem Gesicht, seiner Haltung, zu lesen. "Jemanden suchen? Wofür?"
-
»Dir jemanden suchen. Freundinnen, einen Liebhaber.« Menas machte eine undeutliche Bewegung mit der Hand. »Irgendwen eben. Damit du nicht ständig hier allein bist. Das wird dich sonst zugrunde richten.« Menas zwang sich, seinen Becher zu leeren, und stellte ihn mit einem hohlen Geräusch auf den Tisch zurück. Wenn er seine Mutter richtig einschätzte, würde sie nun entweder alles weit von sich schieben und empört sein, oder aber, sie würde es still hinnehmen, einen flachen Kommentar dazu abgeben und sich nicht weiter gedanklich damit aufhalten. Menas seufzte leicht und kratzte sich hinterm Ohr.
-
Sie wollte gerade einen weiteren Schluck Wein nehmen, um ihre Überraschung zu verbergen, als Marcus das Wort Liebhaber in den Mund nahm. Casca verschluckte sich und unterdrückte den Hustenreiz, während Marcus weitersprach, aber schließlich ging es nicht mehr. Sie hielt sich eine Hand vor den Mund und beugte sich leicht nach vorn, während sie hustete. "Einen Liebhaber?!?" Das war eines der wenigen Themen, womit Casca aus der Fassung gebracht werden konnte – zumal wenn ihr Sohn es war, der es anschnitt. All die Jahre hatte sie nie daran gedacht, sich einen Liebhaber zu nehmen. Sie hatte es sich sogar verboten davon zu träumen, die Tagträume jedenfalls, die sie beeinflussen konnte. Sie spürte, wie sie rot wurde. "Ich. Ähm. Wie… wie kommst du darauf? Marcus, du…" Sie wurde sich bewusst, dass sie gerade stotterte, und hätte sich am liebsten erneut hinter dem Weinbecher verkrochen, aber sie hatte Angst, sich dann erneut zu verschlucken. Und was sollte sie schon sagen? Dass sie verheiratet war? Dass sie eine Mutter war, seine Mutter? Oder dass sie nicht so allein war? Sie starrte ihn weiter an, und nach und nach erst ging ihr auf, was er noch gesagt hatte. Dass es sie sonst zugrunde richten würde. Ihre Augen weiteten sich noch etwas. "Wie kommst du auf die Idee, es könnte mich zugrunde richten?"
-
Menas betrachtete seine Mutter, wie sie sich brüskierte. Er hatte sie nicht aufregen wollen, aber das war gründlich fehlgeschlagen. Was mochten sie wohl in diesem Moment für Gedanken beschäftigen? Er konnte es nicht erahnen. Menas lehnte sich zurück. Was brachte es schon, zu lügen, nur um sie nicht zu beunruhigen? »Ich höre dich nachts, manchmal. Und du hast oft diesen Zug um die Lippen, wenn du denkst, es schaut niemand hin. Und wenn du ehrlich mit dir bist, dann wünscht du dir auch nicht, dass Vater dich besuchen kommt. Warum nimmst du dir nicht jemanden, einen Sklaven? Hipponax zum Beispiel. Du bist eine gut aussehende Frau. Warum solltest du darauf verzichten? Vater hat diese Blondine, und wir beide wissen, dass sie nicht nur zum Getränke servieren bei ihm in Mantua ist, Mutter.« Menas sagte das mit beinahe kühler Berechnung. Doch das anschließende Lächeln strafte seinen Tonfall Lügen. Er zuckte mit den Schultern und begann, mit dem leeren Becher auf dem Tisch zu spielen. »Oder geh öfter in die Thermen, da lernt man doch oft Leute kennen, mit denen man auch etwas anfangen kann.«
-
Was für Gedanken beschäftigten Casca? Wie Blitze leuchteten verschiedene Momente ihres Lebens auf – Nächte, in denen sie mit Tiberius das Bett geteilt hatte, und so viel mehr, in denen sie sich gewünscht hatte, er möge kommen. Weil sie seine Frau war. Weil es so sein sollte, zwischen Eheleuten. Weil sie sich nach Nähe gesehnt hatte, nach Wärme und Zuneigung. Das hatte ihr irgendwann die Gegenwart Marcus’ gegeben, aber ein Sohn, ein Kind war nun einmal etwas anderes als der Ehemann. Und immer war ihr im Vordergrund gestanden, ihren Sohn nicht zu belasten. Nie mehr zu fordern, als er zu geben bereit war. Irgendwann war auch der Wunsch verschwunden, dass Tiberius kommen möge, aber der Wunsch nach Zuneigung war geblieben.
Als sie Marcus’ Antwort hörte, wünschte sie sich fast, sie hätte nicht gefragt. Er hörte sie nachts? Jetzt biss sie sich auf die Unterlippe. Sie fühlte sich einsam, zuweilen. Und gerade nachts, wenn sie sich im Halbschlaf befand, aber nicht zur Gänze einschlafen konnte, konnte sie gegen das Gefühl der Einsamkeit nicht immer ankämpfen – und nachts, wenn sie allein war, sah sie auch nicht immer den Sinn darin. Sie wollte schon antworten, etwas Beschwichtigendes, aber Marcus sprach bereits weiter, und sie schwieg, hörte ihn zu Ende an – und wünschte sich erneut, sie hätte ihn unterbrochen. Nein, sie wünschte sich nicht, nicht mehr, dass Tiberius kam. Daher spielte es für sie auch nicht wirklich eine Rolle, was er mit seiner Sklavin in Mantua machte. Aber dass sie selbst sich ebenfalls einen Sklaven "nahm", wie Marcus dies ausdrückte, stand ihr ebenfalls fern. Es war nicht ihr Stil, und obwohl auch ihr dann und wann dieser Gedanke gekommen war, hatte sie ihn immer recht schnell fort geschoben. Weil sie eine gute Ehefrau und Mutter war, wie sie dachte. Wenn sie ehrlich zu sich selbst wäre, müsste sie sich eingestehen, dass sie auch Angst hatte, Angst, sich zu öffnen, Angst, sich auf einen anderen einzulassen, Angst vor der Reaktion. Aber das gestand sie sich nicht ein.
Sie wollte beschwichtigen, wollte abwiegeln. Wollte ihm die Sorgen um sie nehmen. Aber sie erkannte, dass es dafür zu spät war. Er hatte mehr gesehen als sie ihn hatte sehen lassen wollen, und das konnte sie nicht mehr rückgängig machen. In ihren Augen war eine leise Trauer zu erkennen, als sie ihren Sohn ansah. "Es scheint, du kennst mich besser als ich dachte. Verzeih mir, Marcus. Ich habe immer versucht, meine Sorgen von dir fern zu halten." Sie wandte den Kopf und sah aus dem Fenster hinaus, und ihr Blick schien für Momente in weite Ferne zu schweifen. "Dass dein Vater kommt… nein. Diesen Wunsch hege ich schon lang nicht mehr. Und wenn wir schon ehrlich sind, er wohl genauso wenig." Sie forstete in sich nach den Gefühlen, die dieser Satz in ihr auslöste. Es stach, weil ihre Ehe an diesen Punkt gekommen war – aber es schmerzte nicht mehr. Hatte es je geschmerzt, wegen Tiberius? Oder war es immer nur die Ehe gewesen, diese Institution, und ihr Unvermögen als Ehefrau, die sie getroffen hatte? Sie sah Marcus wieder an. "Ich weiß, warum seine Sklavin in Mantua ist." In erster Linie weil sie seine Vertraute war. In jeder Hinsicht. "Einen Sklaven… Marcus, ich…" Jetzt machte sich wieder etwas Verlegenheit breit. Sprach sie hier gerade mit ihrem Sohn darüber, sich einen Liebhaber zu nehmen? Schließlich meinte sie ruhig: "Es ist nicht so, dass mir nicht hin und wieder der Gedanke gekommen wäre. Aber du kennst mich. Es ist nicht… meine Art. Ich habe nie gelernt, worauf es dabei ankommt. Genauso wenig habe ich gelernt, wie man Menschen kennen lernt…" Sie seufzte. "Vielleicht hast du Recht."
-
Mehrmals atmete seine Mutter ein, hielt den Atem kurz und entließ ihn dann wieder. Sie hatte etwas sagen wollen, doch entweder selbst darauf verzichtet oder zugunsten von Menas' Worten geschwiegen. Dann sah sie fort, und als ihr Blick wieder zurück schwenkte, war er so voller Trauer, dass es Menas die Eingeweide zusammenzog. Er wünschte sich, er hätte es nicht angesprochen. Es lebte sich leichter mit einer Lüge, wenn sie unausgesprochen existierte. »Sag das nicht, Mutter. Du hast nie darüber geredet. Ich kann nicht gehen, wenn ich weiß, dass du dich jede Nacht in den Schlaf weinst.« Das war zwar ein wenig übertrieben, doch Menas war sich sicher, dass seine Mutter verstand, was er damit sagen wollte. »Ein Sklave, ein Plebejer, es ist doch ganz gleich. Du könntest sogar die Geliebte eines Senators oder Patriziers sein. Aber vergeude doch nicht dein Leben an... an...« Menas verstummte und machte eine unwirsche Geste. Seinen Vater meinte er, doch es wollte gerade kein abfälliges Wort über seine Lippen kommen. Verärgert und verwundert darüber, ballte er die Faust und ließ sie auf der Sessellehne locker auf und nieder hüpfen. Plötzlich sah er auf. »Dann wird es Zeit. Geh auf den Markt und lasse etwas fallen. Oder...oder frag jemanden nach dem Weg. Oder ob du dich im Kaltwasserbecken dazusetzen darfst. Es gibt doich so viele Möglichkeiten, Mutter. Lass sie doch nicht ungenutzt verstreichen.«
-
Diesmal konnte Casca ein leichtes Zusammenzucken nicht unterdrücken, als er davon sprach, dass sie sich in den Schlaf weinte. Jede Nacht war übertrieben, aber das war ihm ebenso klar wie ihr. Es ging auch gar nicht darum, wie oft sie tatsächlich weinte des Nachts. Oder wie oft sie schlicht wach lag, mit trockenen Augen, aber einsamem Herzen. Es ging darum, dass er überhaupt darum wusste. Sie schloss für einen Augenblick die Augen. "Du gehst, Marcus." Ihre Lider hoben sich wieder. "Denk nicht an mich. Denk an deinen Wunsch, den du dir erfüllst. Da sollten dir nicht Gedanken um deine Mutter im Weg sein." Sie versuchte zu lächeln, konnte dadurch aber nicht kaschieren, dass sie ihm nicht widersprochen hatte. Dass sie wie zuvor nicht abgestritten hatte, dass sie nicht wirklich glücklich war, nicht auf die Art, die sie nachts ruhig schlafen ließ. Wieder sah sie aus dem Fenster, und als ihr Blick diesmal zurück zu ihrem Sohn glitt, enthielt er eine leise Verblüffung. "Eines Senators oder Patriziers?" Dass er das für möglich hielt, ließ vorübergehend sogar die leichte Verlegenheit darüber verschwinden, dass sie mit ihm überhaupt über dieses Thema sprach. Sie wollte noch etwas sagen, aber seine weiteren Worte erstickten das. Sie wusste, wen er meinte. Und wieder empfand sie eine vage Trauer, diesmal darüber, dass Marcus offenbar tatsächlich der Meinung war, dass sie ihr Leben vergeudete. War es denn Vergeudung, seine Ehe nicht aufgeben zu wollen? Sie sagte es nicht laut, wusste sie doch, dass es ihm gar nicht darum ging, die Ehe gänzlich aufzugeben – obwohl zumindest er wohl kaum etwas dagegen gehabt hätte. Dennoch ließen sie seine Worte grübeln, darüber, ob sie ihr Leben wirklich vergeudete, wie Marcus meinte. War es denn richtig, eine Ehe so zu führen, wie sie es tat? "An deinen Vater", vollendete sie schließlich seinen Satz, als er es nicht tat. Aber was sie sonst noch dazu sagen sollte, könnte, wollte ihr nicht einfallen.
Vielleicht hatte er ja tatsächlich Recht. Vielleicht sollte sie etwas tun – nicht unbedingt sich einen Liebhaber nehmen, obwohl auch dieser Gedanke, einmal tatsächlich offen ausgesprochen, an Reiz gewann. Aber mehr ausgehen. Menschen kennen lernen. Sich Rom ansehen… Es gab viel, was sie schon lange nicht mehr gesehen hatte, und viel, was sie noch nie gesehen hatte. Sie könnte auch Ausflüge in andere Städte unternehmen. Sie könnte… Ihre Gedanken wurden unterbrochen durch Marcus, der plötzlich wieder das Wort ergriff. Dieses Mal musste sie verlegen schmunzeln, als sie seine Vorschläge hörte. "Und du meinst, das funktioniert? Etwas fallen lassen auf dem Markt? Oder in den Thermen… Ich glaube, danach würde ich erst mal kein vernünftiges Wort mehr hervorbringen. Nicht geeignet um jemanden zu beeindrucken." Dann wurde sie wieder etwas ernster. "Marcus… Ich weiß, was du meinst. Und es freut mich, dass du denkst…" Was? Ein Senator könnte sie als Geliebte wollen? "… dass ich so viele Möglichkeiten habe. Ich werde die Augen danach offen halten." War es die Lüge einer Mutter, die ihren Sohn beruhigen wollte? Oder meinte sie es tatsächlich ernst? Casca wusste es selbst nicht so genau zu sagen.
-
Menas machte eine ärgerliche Handbewegung und zog die Brauen zusammen. »Ah, Mutter, wie könnte ich gehen, ohne einen Gedanken an dich zu verschwenden?« fragte er sie und sprach sogleich weiter. »Das wäre nicht nur undankbar, sondern auch ausgesprochen...herzlos.« Wobei Menas sonst auch nicht sonderlich viel Herz hatte. Er griff erneut nach dem Weinbecher, sah kurz in das tiefdunkle Rot des verbliebenen Weines und kippte selbigen dann hinunter. Nur kurz verzpg er die Lippen ob der Herbheit des Rebensaftes, dann platzierte er erneut den Becher akkurat auf dem Tisch.
Auf ihre verwunderte Nachfrage hin sah er sie nur direkt und offen an. Sie wusste, dass er es ernst meinte, da bedurfte es auch keiner weiteren Versicherung, dass dem tatsächlich so war. Wäre er selbst einer dieser eingebildeten Schnösel, so wäre ihm seine Mutter definitiv ins Auge gefallen, und wer sagte denn, dass es nicht einen reichen Römer gab, der Gefallen an ihr finden und ihr Abwechslung von der Tristesse des einsamen Alltags offerieren würde? Auch als sie seinen Satz vollendete, erwiderte er nichts. Was hätte er auch großartig sagen sollen? Er ließ stattdessen seine Fingerspitzen über die wellige Oberfläche des Korbsessels gleiten und beobachtete Casca eindringlich und ungeniert.
»Warum nicht? Ich kenne längst nicht alle Tricks und Kniffe, derer sich eine Frau bedienen kann. Aber ich bin zuversichtlich, dass dir etwas einfällt, wenn du es nur willst. Im Grunde steht es mir auch gar nicht zu, so mit dir zu reden. Aber soll ein Sohn nicht stets aufrichtig zu seiner Mutter sein?« fragte er rhetorisch und hakte damit das Thema für sich ab. Wenn Casca Interesse an etwas Spaß hatte, würde sie vielerlei Möglichkeiten haben, an selbigen heranzukommen. Ganz glaubte er ihr allerdings nicht, dass sie tatsächlich die Augen offen halten würde. Es war Menas schon ein Rätsel, wie sie es so lange Zeit an der Seite seines nie anwesenden Vaters ausgehalten hatte. Sicherlich würde sie das Vorhaben nur allzu bald wieder verwerfen, sich nach geeigneter Ablenkung umzusehen. Menas räusperte sich und sah zum Fenster. Es wurde stetig dunkler. »Meinst du, sie lassen mich Sacadas mitnehmen?« fragte er ins Zwielicht hinein.
-
Casca meinte den unterdrückten Ärger zu sehen in der abgehackten Handbewegung, die Marcus machte. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass ihr Sohn voller Unruhe steckte, aber bei der langen Wartezeit, die die letzten Jahre für ihn bedeutet hatten, war das auch kein Wunder. Sie nahm aber ebenfalls die Besorgnis wahr, die in seinen Worten nach wie vor mitschwang. Sie lächelte. "Nun ja, als Mutter muss ich es wenigstens einmal sagen. Aber es freut mich, dass du an mich denkst." Sie sah zu, wie er seinen Becher leerte, und trank ebenfalls einen Schluck. Sie erwiderte seinen Blick ebenso offen, wissend, dass er seine Worte ernst gemeint hatte, aber nicht glauben könnend, dass Männer von derartigem Rang Interesse an ihr haben könnten. Er betrachtete sie mit dem Blick eines Sohnes, der sie liebte, daher musste er seine Überzeugung nehmen. Aber ein Teil von ihr fühlte sich doch mehr geschmeichelt, als sie sich selbst eingestehen wollte.
Marcus’ Blick schien sich etwas zu wandeln, schien eindringlicher zu werden, und für einen Moment grübelte sie, worüber er nun wohl nachdachte, während sie einen weiteren Schluck Wein trank. Erneut blickte sie, kurz diesmal, aus dem Fenster, bevor sie zurücksah zu ihm. "Ich glaube, du kennst mehr dieser Tricks als ich. Aber gut, wer weiß, was mir einfällt. Mitunter kann ich durchaus kreativ sein." Sie lächelte, etwas versonnen, in Erinnerung versunken. Dann sah sie wieder auf. "Und denk dir nichts dabei, wie du mit mir redest. Sei aufrichtig, ja, das ist alles, was ich möchte." Sie ahnte, dass Marcus ihr nicht so recht glaubte, dass sie sich umsehen, offener werden, versuchen würde, mehr aus ihrem Leben zu holen als bisher. Sie selbst war sich nicht so sicher, ob Marcus damit Recht hatte. Sie wusste so gut wie er, dass die Einsamkeit nur noch stärker werden würde, jetzt, wo er ebenfalls ging – auch wenn er in Rom blieb. Sie musste etwas dagegen tun, irgendetwas, wollte sie daran nicht auf Dauer langsam, aber sicher zugrunde gehen. Marcus jetzt aber noch mehr zu sagen, dazu war sie sich nicht bereit, war sie sich doch selbst noch nicht sicher, was dieses Gespräch bei ihr bewirken würde. Und sie wusste auch gar nicht, was sie noch sagen sollte dazu – darüber hinaus hatte sie das Gefühl, auch Marcus hatte genug von diesem Thema, was sich auch kurz darauf bestätigte, als er etwas anderes ansprach. Hätte weiter darüber reden wollen, hätte er es getan.
Casca zuckte leicht mit den Achseln, nippte wieder an ihrem Wein und stellte den Becher dann vorübergehend ab. "Ich weiß es nicht, wie es bei den Kohorten gehandhabt wird." Sie konnte sich allerdings nicht wirklich vorstellen, dass den Rekruten gewährt wurde, ihre Sklaven mitzunehmen. "Bei der Legion ist es für normale Soldaten nicht möglich, soweit ich weiß. Ich denke, dass es bei den Kohorten genauso sein wird… Allerdings habe ich nicht wirklich eine Ahnung."
-
Ein wenig zu lange, um noch beifällig zu wirken, taxierte Menas seine Mutter, ehe er den Blick abwandte und in dem so vertrauten Raum umherschweifen ließ. Was sollte er noch erwidern? Welches Thema sollte er noch ansprechen? Immerhin schien er es geschafft zu haben, dass sie mehr über sich selbst nachgrübelte als über ihn und seinen Fortgang. Ihre Erwiderung Sacadas bezüglich hatte er sich selbst ebenfalls schon gedacht. Er würde es dennoch versuchen, morgen, und nötigenfalls in den sauren Apfel beißen. Wenn er nur schnell genug zum Zenturio würde, dann wäre sein Geheimnis vielleicht immer noch wohl behütet und keinem würde es jemals auffallen. Und wenn dann erst Sacadas in seiner Nähe wäre...
Menas seufzte leise und rieb sich die Stirn, nun wieder seine Mutter mit einem Blick bedenkend. Er argwöhnte, dass sie ihm wohl täglich schreiben würde. Hoffentlich machte er sich damit nicht zum Gespött seiner Einheit, wenn er tagtäglich Post von daheim bekam. Andererseits würde das seiner Mutter mit Sicherheit helfen, und das war es dann allemal wert. In Ermangelung eines weiteren Themas und ohne das Bedürfnis, über Belanglosigkeiten zu sprechen, lehnte Menas sich vor, ergriff die Weinkaraffe und schenkte seiner Mutter nach. Sich selbst ließ er aus, dann stellte er den Krug wieder zurück auf den Tisch.
-
In dem dunkler werdenden Zimmer musterte Casca ihren Sohn, fragte sich, was ihn wohl erwarten würde. Sie machte sich nach wie vor Sorgen um ihn. Zum Militär zu gehen, war sein sehnlichster Wunsch, sie wusste das, und das war es nun schon so lange, dass sie auch wusste, dass es weder ein Kinder- oder Jugendtraum gewesen war, der von selbst wieder vergehen würde, noch dass er sich davon abbringen lassen würde. Marcus musste und würde diesen Weg gehen, wenn er das wollte. Trotzdem zweifelte sie – nicht daran, ob ihre oder Tiberius’ Entscheidung als Eltern richtig war, ihn ziehen zu lassen, aber ob es richtig von ihm war, ausgerechnet diesen Weg zu wählen. Er wusste doch besser als jeder andere, was ihn behinderte. Casca dachte dabei weniger daran, was passieren mochte, wenn jemand bei den Kohorten herausfand, wie es um Marcus’ Gesundheit bestellt war, sondern eher, was passieren mochte, wenn er wieder einen Anfall bekam – und es musste noch nicht einmal in einer gefährlichen Situation sein. Es reichte schon, wenn er gerade am Trainieren war mit einem Kameraden, und dieser zu spät merkte, was los war. Und Marcus selbst war dies auch bewusst, sonst würde er sich nicht Gedanken darüber machen, ob er Sacadas würde mitnehmen können. Sie nahm erneut einen Schluck aus ihrem Becher, den Marcus wieder aufgefüllt hatte. Ihr selbst wäre auch wohler, wüsste sie Sacadas an seiner Seite. Der Sklave begleitete ihren Sohn nun schon lange, er kannte ihn, und er wusste, was zu tun war. Aber es führte kein Weg daran vorbei, dass Marcus, zumindest zunächst, sich allein würde durchschlagen müssen. Entgegen ihrer sonstigen Einstellung, wenn sie über ihren Sohn nachdachte, kam ihr flüchtig der Gedanke, dass es ihm vielleicht ganz gut tat, wenn er eine Zeitlang ohne Hilfe zurecht kommen musste, ohne sie, die immer hinter ihm stand, und ohne Sacadas, der bisher stets zur Stelle gewesen war, wenn er ihn brauchte, wie es sich für einen guten Sklaven gehörte.
Einige Zeit verging in Schweigen, das erst gebrochen wurde, kurz bevor es zu dunkel wurde. Ein leises Klopfen war zu hören und kurz darauf Phila zu sehen, ihre Leibsklavin, die abwartend in der Tür stehen blieb, in ihren Händen ein langer, brennender Span. "Herrin?" Casca sah auf und winkte die Sklavin herein. "Du kannst die Öllampen anzünden. Und…" Während die Sklavin durch den Raum ging und dieser schon bald vom warmen Licht der Flammen erhellt wurde, wandte Casca sich an Marcus. "Möchtest du etwas essen?" Sie wartete seine Antwort ab und schickte Phila dann wieder hinaus, bevor sie sich erneut ihm zuwandte. "Wann wirst du Bescheid wissen? Ich denke doch, dass du einige Tests über dich wirst ergehen lassen müssen – weißt du wie lange es dauern wird, bis du endgültig aufgenommen bist?" Dass er aufgenommen werden würde, daran bestand für Casca kein Zweifel – wenn er nicht gerade einen Anfall bekam, während er untersucht wurde.
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!