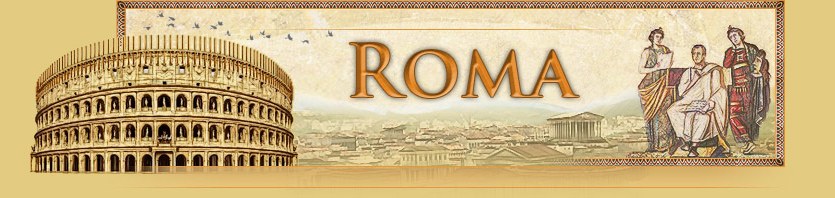Die Villa hatte ich hinter mir gelassen und damit auch mein altes Leben. Noch war ich guten Mutes, bis am Ende dieses Tages eine neue Aussicht gefunden zu haben. Der kleine Diarmuid tippelte tapfer neben mir her. Auch ihm schien der Ausflug in die Stadt zu gefallen. Für den Kleinen gab es so viel zu entdecken, was er noch nicht kannte.
Ich hielt die Augen und Ohren auf, um einen Hinweis zu finden, wo es Arbeit mit einem entsprechenden Lohn gab,damit ich Essen kaufen konnte und mich um eine Bleibe sorgen konnte. Dass dies nicht einfach werden würde, hatte ich mir noch vorstellen können. Zwar hatte ich darin noch keinerlei Erfahrung aber so schwer konnte das doch auch nicht sein!
Einige Stunden später hatte sich mein Enthusiasmus schon etwas gelegt. Bisher hatte ich niemanden gefunden, der für mich Arbeit, geschweige denn etwas zu Essen oder ein Dach über dem Kopf hatte. Der Kleine wollte auch nicht mehr laufen. Mit jedem Schritt wurde er müder und unleidlicher, was zur Folge hatte, dass ich ihn tragen musste. Mein Magen knurrte, aber das versuchte ich zu ignorieren.
Für einen kleinen Atemzug dachte ich daran, wieder in die Villa Flavia zurückzukehren. Doch den Gedanken verwarf ich ganz schnell wieder. Ganz erschöpft ließ ich mich an einem Brunnen nieder. Das kalte Wasser linderte meinen Durst und vertrieb wenigstens für eine Weile den Hunger. Mutlos starrte ich vor mich hin und begann mir Vorwürfe zu machen. Wie konnte ich nur so blauäugig sein?
Ein neuer Tag hält viel bereit
-
-
Casticus, war das erste mal in Rom und war überwältigt von der größe und schönheit dieser Stadt. Er schreitet auf den straßen Roms entlang und weiß noch nichts recht mit sich anzufangen. Doch auf einmal sieht er diese Frau am Brunnen und ging zu ihr und fragte sie:
"Warum schaut ihr so trauig rein?" -
Der Welt um mich herum schenkte ich keine Aufmerksamkeit. Ich kannte hier niemand und niemand kannte mich, was letztlich auch der Grund war, weswegen ich auf lange Sicht scheitern würde. Mein Kind hatte die Augen geschlossen und versuchte zu schlafen. Noch war die Müdigkeit größer als der Hunger. Aber es war nur eine Frage der Zeit, bis das Verhältnis sich änderte. Dann hatte ich eine Sorge mehr! Wenigstens einen Augenblick wollte ich noch innehalten, bevor ich weiter ging.
Dann hörte ich eine Stimme, die zu mir sprach. Ein Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, hatte mich angesprochen. Weshalb sollte ihm etwas an mir gelegen sein? Ich musterte den Mann von oben bis unten. Wie jemand von hier sah er nicht gerade aus. Aber diese Stadt gab so vielen Fremden eine neue Heimat, gewollt oder auch ungewollt.Ich bin nicht traurig. Man könnte sagen, ich bin etwas entmutigt, aber traurig bin ich nicht.
Es war meine eigene Entscheidung, hier zu sein. Eigentlich hätte ich glücklich sein müssen. Aber genauso wenig wie ich am Tage meiner Freilassung glücklich war, war ich auch jetzt nicht glücklich.
Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Für mein Kind und mich brauche ich etwas zu Essen und eine Unterkunft.
Ich machte mir keine großen Hoffnungen, dass der Fremde der Schlüssel zu all meinen Sorgen war. Aber wer wusste das schon!
-
Casticus, war aus den gleichen Gründen nach Rom gekommen den auch er suchte Arbeit und eine Unterkunft. Ürsprünklich kam er aus Germanien und wollte sein Glück hir versuchen.
"Ich habe zwar nur 10 Sesterzen."
Sagte her und bot folgendes an.
"Arbeit und Unterkunft habe ich leider nicht aber ich könnte euch zum essen einladen."
-
Auch wenn es sich hoffnungslos anhörte, was ich gesagt hatte, so hatte ich nicht die Absicht, auf diesem Wege zu betteln oder Almosen einzusammeln. Der Mann, der mich angesprochen hatte, war in einer ähnlichen Situation, wie ich selbst. Aus diesem Grund schon, konnte ich sein Angebot nicht annahmen. Doch das war es nicht allein.
Nein danke für dein nettes Angebot. Aber behalte lieber dein Geld.Ich stand auf und ging weiter.
-
Ziellos streifte ich weiter durch die Straßen der Stadt. Längst hatte ich die Orientierung verloren. Die Umgebung, in der ich mich schließlich wieder fand, erschien mir so fremd. Dieser Teil der Stadt hatte rein gar nichts mehr mit den feinen Wohngegenden zu tun, in denen sich die herrschaftlichen Villen der Großen der Stadt, befanden. Die Häuser wirkten düster und schmutzig und ein übler Geruch, der entsteht, wenn viele Menschen dicht aufeinander leben mussten, hing in der Luft. War ich hier am Ziel angekommen? War es das, wonach ich insgeheim gesucht hatte? Ich konnte mich nicht wirklich mit dem Gedanken anfreunden, hier meine Zukunft finden zu können. Es war einfach nur hochmütig von mir gewesen, das Angebot des Fremden abzulehnen. Ich konnte es mir einfach nicht mehr leisten, auf Almosen zu verzichten. Doch diese Chance war vertan. Je größer der Hunger wurde, desto größer wurden auch meine Selbstvorwürfe, die ich mir machte. Ich musste mir selbst die Frage stellen, was mich nur dazu getrieben hatte, mein bisheriges Leben abzustreifen und einfach so wegzuwerfen, in dem ich doch eigentlich alles hatte, was man brauchte, um zu leben. Ich hatte ein schützendes Dach über dem Kopf und regelmäßiges Essen gegen die Ungewissheit einer unbestimmten Zukunft eingetauscht. Wahrhaftig, ich musste verrückt sein!
Nicht nur mir knurrte der Magen unerbittlich. Auch der Kleine wurde zunehmend unruhiger. Er wimmerte vor Hunger vor sich hin. Das Schlimmste war für mich, dass ich ihm nicht helfen konnte. Eine alte Frau, von der ich es am wenigsten erwartet hatte, zeigte schließlich Mitleid, obwohl sie doch selbst kaum etwas hatte. Sie steckte dem Kleinen ein Stück Brot zu. Das stillte für eine Weile seinen Hunger.Ich musste mich fragen, ob es nicht selbstsüchtig von mir gewesen war, den Kleinen mitzunehmen. Er hatte nun unter meiner Unzulänglichkeit am meisten zu leiden. Es wäre für ihn besser gewesen, in der Villa zu bleiben, oder sogar von einer anderen Mutter geboren worden zu sein, während ich begann, mich ins Unglück zu stürzen. Ich war mir am Morgen nicht über die Folgen meines Tuns im Klaren gewesen. Im Angesicht meines Scheiterns fragte ich mich, was aus meinem Söhnchen wurde, wenn ich zugrunde ging. Wer würde sich seiner annehmen? Dieses schutzlose kleine Wesen, das vor Erschöpfung in meinen Armen eingeschlafen war, war dann einer erbarmungslosen Welt ausgeliefert, die nicht davor zurück schreckte, ihm sein höchstes Gut zu nehmen, seine Freiheit! Dann war alles umsonst gewesen. Ja, ich hatte versagt! Auf ganzer Linie hatte ich versagt, weil ich nur an mich gedacht hatte. Wieder war ich dabei, ein Leben zu zerstören. Diesmal war es das meines eigenen Sohnesm, dem, dem ich das Leben doch erst vor Monaten geschenkt hatte. Hätte mich doch damals nur die Mórrígan geholt!
Der Tag war verloren, der Abend brach schon an und ich hatte noch immer keine Unterkunft. Wie sehr sehnte ich mich doch nach einem Ort, wie der stickigen Sklavenunterkunft in der Villa Flavia! Nicht einmal das hatte ich auftreiben können, für mein Söhnchen und mich. So bleib mir nichts anderes übrig, als mich auf eine Nacht unter freiem Himmel einzustellen. Es war für mich nicht das erste Mal, dass ich draußen schlief, wohl aber für mein Kind. Die Nacht würde frisch und ungemütlich werden, das war gewiss. Wenigstens wollte ich mich nach einem geschützten Plätzchen umsehen.
Im Dunkel sahen die Häuser alle gleich aus. Die Ruhe der hereinbrechenden Nacht breitete sich allmählich über das Viertel aus. Die Geschäftigkeit des Tages war auf mysteriöse Weise verschwunden. Das Kindergeschrei hatte sich erheblich auf ein Minimum reduziert. Hier und da hörte man das Geschrei von streitenden Katzen. Der Mond war zu meiner einzigen Leuchte geworden. Er hatte mir schließlich den Weg zu einer geschützten Nische zwischen zwei Häusern gewiesen. Dort ließ ich mich endlich nieder, kurz bevor meine Füße endgültig versagten. Mein Kind schmiegte ich dicht an mich, damit ich ihm wenigstens etwas Wärme geben konnte. Irgendwann war auch ich eingeschlafen, obwohl ich schon ahnte, der morgige Tag würde mich nur noch tiefer in die Misere treiben. -
Glabrio konnte nicht schlafen. Der Husten plagte ihn immer schlimmer, es schmerzte und vor allem konnte er sich davon kaum noch ablenken, immerzu musste er daran denken, wo er einen Arzt finden würde und wie er diesen bezahlen sollte. Doch in dieser Nacht, als er nicht einschlafen konnte, weil der Schmerz in seiner Brust ihn immer wieder hochriss, hatte sich noch eine andere Sorge in seinen Kopf geschlichen und er war schliesslich aufgestanden, hatte sich angezogen und war auf die Straße hinausgetreten um ein wenig Bewegung und - so weit in Rom möglich - frische Luft zu kriegen. Er wusste dass das gefährlich war, aber die Räuber und andere nächtliche Gefahren liessen ihn schon lange unberührt, er würde das Risiko gerne eingehen, wenn er sich nur nicht weiter in seinem Bett herumwälzen musste. Das war immer so: nachts sah alles noch viel schlimmer aus, am nächsten Tag würde alles wieder einigermassen gut sein und mit dem Licht der Sonne würde auch die Helligkeit wieder Einzug in sein Leben haben. Doch obwohl Glabrio das wusste, er konnte die Gedanken nicht beiseite schieben: WARUM?
Sicherlich, die einfache Antwort wäre gewesen: Die Stadtluft bekommt nicht, der ganze Staub, den er eingeatmet hatte zerstörte seine Gesundheit. Aber es schien ihm in dieser Nacht, als liege der Grund viel tiefer. War der Husten, der ihn plagte ein Zeichen? Nicht so ein Zeichen, wie sie die Römer - manchmal vergass er fast, dass er selbst auch zu diesem Volk gehörte - sie überall sahen: Blitze, die zufällig Statuen trafen und zum Schmelzen brachten oder auch nur ein Adler, der über dem Forum seine Kreise drehte konnten die Römer aus der Fassung bringen. Einen Tag lang war nur noch von solchen lächerlichen "Wundern" die Rede, am nächsten Tag war alles wieder vergessen.
Aber auch für Glabrio musste es Zeichen und Wunder geben. Die heilige Schrift erzählte davon, Jesus hatte sie gewirkt, davon war viel berichtet worden. Doch würde er auch jetzt noch, auch in sein Leben eingreifen, ihm einen Wink geben? Möglich war es immerhin. Und Gründe fielen Glabrio natürlich auch reichlich ein. In der letzten Zeit hatte er sich viel zu sehr auf sich konzentriert, hatte alles in die Taberna investiert, sein Geld, seine Zeit, seine Sorgfalt und Liebe. Hatte er nicht seine Brüder und Schwestern im Stich gelassen? Doch nicht nur das, er hatte auch seine eigenen ehrgeizigen Ziele nicht mehr verfolgt: Wollte er nicht noch vor kurzem einen Patron für die Christen in Rom finden, zum Kaiser gehen, vorm Senat sprechen, das Evangelium auf seine Art verkündigen? Nichts davon hatte er wahrgemacht. Er fühlte sich schlecht.
Mit eiligen Schritten irrte er durch das Stadtviertel, ohne Ziel. Er hatte Tränen in den Augen, die ihm langsam die Wangen herabliefen und wünschte sich, es würde regnen, dann würden sie weggewaschen und vielleicht mit dem Regen zu seinem Erlöser gebracht werden. Sein Erlöser... Im Augenblick schien der ihm ziemlich fern, er rief nach ihm, rief laut - nicht nur im Kopf, rief verzweifelt. Doch natürlich wurde er nicht gehört. Rom schlief - und der Teil von Rom der nicht schlief... nun der hielt ihn vielleicht für verrückt und deswegen nicht eines Überfalls Wert.
Glabrio schrie: "Herr, wo bist Du? Hörst Du mich nicht?"
Zum Glück wurde er unterbrochen, möglicherweise hätte er sonst die Anwohner geweckt oder sogar die Soldaten der Stadtwache auf sich gehetzt. Das Geschrei eines Säuglings unterbrach ihn und brachte ihn jäh zum Schweigen. Wie angewurzelt blieb er stehen. Ein schauderndes Gefühl, unbeschreiblich - es erschien ihm so unendlich bedeutsam, dieser Schrei, der ihm wie eine Antwort vorkam - durchfloss seinen ganzen Körper.
Er schaute zum Himmel, beendete sein Gebet, dankbar, eine Reaktion hervorgerufen zu haben aber ungewiss, wie es weitergehen sollte und machte sich dann auf die Suche nach dem Kleinkind. Das Weinen - es klang schwach in Glabrios Ohren - war ungedämpft, das Baby musste sich ebenso auf der Strasse "aufhalten" wie er. Es war nicht schwierig, dem Geschrei zu folgen, bald stand er vor einer Frauengestalt, die am Boden in einer Nische an einer Hauswand lehnte und den Säugling hielt. Als er vor ihr stand, warf er seinen Schatten auf sie, er hatte die Kapuze seines Mantels über den Kopf gezogen und blickte schweigend auf die beiden armseligen Gestalten herab. Nach einem kurzen Augenblick besann er sich, kniete sich hin und zog die Kapuze zurück. "Fürchtet euch nicht...", sagte er und fühlte sich lächerlich, dass er Engel zitierte, doch das war was er sagen musste. "Ich werde Euch nichts tun."
Wieso sprach er das Kind an, es würde ihn sowieso nicht verstehen. Aber es hatte ihn gerufen, also sah Glabrio es als etwas Besonderes an. -
Das plötzlich beginnende Wimmern Diarmuids, welches sich binnen Minuten zu einem Schreien steigerte, hatte mich abrupt aus meinem traumlosen Schlaf gerissen. Ich war zu erschöpft gewesen, um zu Träumen. Jetzt war ich wieder wach und mein Kleiner war es auch. Es dauerte nicht lange, bis ich die Ursache für seinen Protest feststellte. Er hatte sich an den Beinen freigestrampelt und fror jetzt. Wenn das Kind jetzt auch noch krank werden würde, dann war alles aus! Schnell bedeckte ich seine Beinchen wieder mit der Decke, die ich um ihn geschlungen hatte. Damit er sich nun noch beruhigen konnte, wiegte ich ihn ein wenig in meinen Armen. Natürlich war es nicht nur die Kälte gewesen, die ihn hatte so schreien lassen. Es war auch der Hunger, der ihn quälte. Das Stückchen Brot, das die alte Frau ihm geschenkt hatte war längst aufgebraucht. Ich selbst hatte davon kein Stückchen angerührt.
Fast schon glaubte ich, Diarmuid beruhigt zu haben, da hörte ich ein lautes Schreien. Ein Mann, ein Betrunkener wahrscheinlich, rief nach seinem Herrn. Oh, die bean sidhe sollte ihn holen! Warum konnte er nicht einfach Still sei? Diarmuids Schrein wurde wieder lauter. Der Kleine musste die Angst spüren, die ich auf einmal empfand. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich mich verstecken sollte. Im Schein des Mondes konnte ich keine Fluchtmöglichkeit für mich und mein Kind entdecken. Wenn es mir gelang, den Kleinen zum Schweigen zu bringen, War vielleicht die Chance größer, hier unentdeckt zu bleiben.
Die Schritte des Schreihalses kamen näher. Diarmuid schrie noch immer und blieb von meinen Bemühungen unbeeindruckt. Ich drückte das Kind ganz dicht an mich, um so sein schreien etwas zu dämpfen. Zu Brigid sandte ich ein Stoßgebet, der Mann möge so betrunken sein, dass ihm Diarmuids Schreien nicht herlocken würde. Doch mein Beten half nicht fiel. Vor mir baute sich eine dunkel Gestallt auf, eingehüllt in einen Umhang mit Kapuze.
Das war jetzt das Ende! Ich zitterte am ganzen Leib vor Angst. Mir war es gleich, was er mit mir anstellen würde. Meine ganze Sorge galt dem Kleinen. Er durfte ihm nichts zuleide tun!Bitte! Bitte tu meinem Kind nichts! Ich bitte dich!
Mit meinen Füßen versuchte ich mich noch weiter nach hinten an die Wand zu drücken, um seinen Übergriffen zu entgehen. Er kniete sich zu mir hinunter und zog seine Kapuze herunter. Das änderte nichts an meiner Angst und an meinem Zittern. Doch dann sagte er etwas, was sich anhörte, wie, wir sollten uns nicht fürchten und er würde uns nichts tun. Ich war mir unschlüssig, ob ich ihm glauben sollte. Leute, die nachts durch die Gassen zogen und laut schrien, waren in meinen Augen nicht sehr vertrauenswürdig.
Warum schreist du hier so herum? Suchst du jemanden? Außer uns beiden ist hier niemand!
-
Die Frau mit ihrem Kind wich vor ihm zurück, obwohl er sich hingekniet hatte. Es tat ihm weh, dass sie ihm nicht vertraute, doch natürlich durfte sie ihm nicht vertrauen. Es war gefährlich in Rom naiv zu sein!
"Ich werde Deinem Kind nichts tun. Und Dir auch nicht. Ich möchte Euch helfen." Würde Sie ihm jetzt glauben? Natürlich hatte er nicht den besten Eindruck gemacht, sie hatte ihn sicher schreien gehört - sie fragte sogar nach.
Glabrio senkte den Kopf und tat die Frage ab: "Naja... Ja, ich habe jemanden gesucht..." Dann hob er seinen Blick und lächelte sie an: "Vielleicht habe ihn schon gefunden."
Das konnte sie nicht verstehen, hätte Glabrio sich reden gehört, hätte er sich vermutlich an den Kopf gefasst und hätte sich tausendmal entschuldigt für die Verwirrung die er stiftete. Doch ihm war nicht zu bewusst, was vor sich ging. Er wollte bloss diesen beiden armen Geschöpfen helfen. Von ferne hörte er das Singen eines Betrunkenen, das aber nur für einen kurzen Augenblick näher zu kommen schien. Doch auch die Frau hatte es gehört und Glabrio griff entschlossen aber dennoch vorsichtig nach ihrem Arm und sagte eindringlich: "Ihr könnt hier nicht bleiben! Folge mir, ich habe eine Taberna, nicht weit von hier, dort seid ihr erst einmal in Sicherheit. Dein Kind kann etwas zu Essen kriegen. Es hat sicher Hunger, sonst würde es nicht so schreien."
Glabrio sah den Zweifel, das Misstrauen und die Angst - die Vernunft - in ihren Augen. Er stand auf und bat sie: "Vertrau mir!" Nun wurde das Gegröle des Betrunkenen wieder lauter und Glabrio warf einen Blick über seine Schulter. Er konnte nichts erkennen, doch das beunruhigende Geräusch liess ihn nur noch flehendlicher auf das Mädchen - wie alt war sie wohl? - und ihr Kind blicken. Hoffentlich würde sie die Naivität siegen lassen, Glabrio wusste nicht, wie er ihr sonst beweisen konnte, dass er ihr nur helfen wollte. -
Die Stimme des fremden Mannes klang mit einem Mal so anders. Freundlich und zart, gar nicht mehr bedrohlich und rauh. Er sagte, er wolle mir helfen, mir und meinem Kind.
Ein Teil in mir wurde gleich misstrauisch und wollte nachhaken, warum er ausgerechnet mir helfen wollte. Er kannte mich doch gar nicht. Aber ich begriff auch sehr schnell, dass ich es mir auf Dauer nicht leisten konnte, misstrauisch zu sein. Die Nacht war frisch und unsere beiden Mägen waren leer. Ich spürte das Hungergefühl schon gar nicht mehr. Ich hatte es hinuntergeschluckt. Aber mein Kind zeigte mir deutlich, dass es den Hunger spüren konnte.
Meine Muskeln lockerten sich. Ich versuchte nicht mehr, mit aller Gewalt zurück zuweichen.
Mir war zwar der Sinn dessen nicht ganz klar, was er noch über denjenigen sagte, den er gesucht hatte, aber sein lächelndes Gesicht sah nicht nach dem eines irren Perversen aus, der es auf junge Frauen mit Kleinen Kindern abgesehen hatte, die auf der Straße übernachten mussten.
Behutsam griff er nach meinem Arm und wollte mir auf helfen. Ich wusste, es stimmte, was er sagte. Es war gar nicht klug, die Nacht auf der Straße zu verbringen. Es war sogar sehr gefährlich! Er bot mir an, mit ihm in seine Taberna zu gehen, wo wir bleiben konnten und wo es etwas zu essen gab. Aber ich war mittellos. Nicht eine Sesterze hatte ich einstecken, womit ich bezahlen konnte.
Das näher kommende Gegröle eines Betrunkenen, half mir, letztendlich schnell eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich dieses überaus großzügige Angebot annahm, dann hatte ich die Gewissheit, diese Nacht einigermaßen gut zu überstehen. Auch dem Kind würde nichts zustoßen. Wenn ich aber jetzt nein sagte, dann war ich in Kürze dem Betrunkenen ausgesetzt.Gut. Ich vertraue dir und komme mit.
Mit seiner Hilfe stand ich auf und versuchte dann den Kleinen wieder zu beruhigen, der immer noch jammervoll schrie. Eines aber sollte er wissen, bevor ich mit ihm ging.
Aber ich habe nichts. Kein Geld. Nichts Wertvolles. Ich kann dich nicht bezahlen für das Essen und die Unterkunft. Ich habe nichts außer mir selbst und meinem Kind.
Ob er jetzt immer noch so zuvorkommend war? Ich war doch nur ein jämmerliches Häufchen Elend, das eine große Dummheit begangen hatte. Dieser Tag hatte mir nicht viel gebracht, außer der Einsicht, dass jemand wie ich nicht damit rechnen konnte, jemals eine Chance zu bekommen.
-
Glabrio atmete auf, sie vertraute ihm. Sie würde mit ihm kommen und sich nicht gegen seine Hilfe wehren. Es musste eine schwierige Entscheidung für sie gewesen sein, doch im Endeffekt die bessere Alternative und natürlich auch die Richtige.
"Dann folge mir!", sagte Glabrio und griff, als das Gegröle des Säufers wieder lauter wurde, intuitiv nach ihrem Handgelenk und führte sie daran in die Richtung, aus der der Lärm kam. Er liess sie aber schnell wieder frei, damit sie das Kind beruhigen konnte, das immer noch wimmerte.
Sie mussten am Störenfried vorbei, sonst würden sie einen grossen Umweg machen müssen um zur Taberna zu gelangen.
Auf ihre Erklärung nickte ich ernst. "Das hatte ich mir schon gedacht. Aber darum geht es nicht. Du kannst erst einmal mitkommen und die Nacht sicher hinter dich bringen, morgen sehen wir weiter!"
Wir näherten uns nun dem Besoffenen, der in breiten Schlangenlinien über die Strasse torkelte und vor sich hin murmelte. Zwischendurch stimmte er Soldatenlieder an, wobei er sich teilweise nicht mehr richtig an die Texte zu erinnern schien.
Als er Glabrio und die junge Frau mit dem Baby erblickte, rief er: "He, Süße! K-k-komm her!" Dabei ignorierte er gekonnt oder einfach wegen seiner eingeschränkten Wahrnehmung Glabrio sowie das weinende Kind und steuerte bedrohlich auf die Fremde zu.
Glabrio wusste nicht, was er tun sollte. Auf einen Kampf mit einem betrunkenen Soldaten sollte er sich nicht einlassen. Dieser wäre sicher stärker und im Rausch konnte so mancher seine ihm sonst selbst vollkommen unbekannten Kräfte nicht mehr kontrollieren. Ausserdem wäre es grundsätzlich falsch sich auf offener Strasse mit diesem Mann zu schlagen.
Also musste Glabrio auf seine Nüchternheit setzen. Der Mann näherte sich erstaunlich schnell, in einer Hand hielt er eine kleine Amphore mit Wein, mit der anderen deutete er auf sein Ziel. Kurz bevor er es erreicht hatte, schob Glabrio die fremde Frau zur Seite und liess den Mann stattdessen in sich hineinlaufen. Er hatte versucht im letzten Moment auch selbst auszuweichen, doch der Betrunkene rempelte ihn heftig an und schüttete eine ganze Menge schlechten Wein über Glabrios Tunika und seinen Mantel. Doch er lief ins Leere und stolperte schliesslich. Glabrio blickte sich kurz um und griff nach der Hand der Fremden, die mit ihrem anderen Arm ihr Kind hielt, und führte oder besser zog sie zur Taberna. -
Ob ich wirklich die richtige Wahl getroffen hatte, ich wusste es nicht. Besser mit dem Fremden gehen und nicht mehr auf der Straße schlafen zu müssen, war im Augenblick die beste Wahl. Ich hatte schon so viel erlebt, in meinem kurzen Leben. Eigentlich konnte mich nichts mehr erschüttern.
Der Fremde nahm mein Handgelenk und zog mich mit sich. Mich beunruhigte es, dass er in die Richtung ging, aus der uns kurze Zeit später der Betrunkene entgegenkam. Er aber lief unbehelligt weiter. Diarmuid kam einfach nicht zur Ruhe. Das musste die meine Angst sein, die sich auf ihn übertrug.
Der Betrunkene kam in Sichtweite. Lallend torkelte er über sie Straße. Meine Schritte wurden schneller. Nur weg von hier dachte ich. Es war ein Glücksfall, dass der Fremde mich gefunden hatte. Nicht auszudenken, wenn ich dem Betrunkenen alleine ausgeliefert gewesen wäre!
Hoffentlich war er so besoffen, dass er uns gar nicht bemerkte. Meine Hoffnung zerschlug sich aber im nächsten Moment. Er hatte uns entdeckt und sprach mich an, dabei kam er immer näher auf mich zu. Vor Schreck bleib ich stehen. Mir war, als gefriere mir das Blut in den Adern. Nichts ging mehr. Meine weitaufgerissenen Augen starrten auf den näherkommenden Mann. Ich konnte bereits seinen stinkenden Atem riechen und rechnete damit, jeden Augenblick von ihm angepöbelt zu werden.
Auf einmal wurde ich zur Seite geschoben. Ich realisierte gar nicht, was geschah. Es war der Fremde gewesen. Der Betrunkene traf statt auf mich, auf den Fremden, dessen Kleidung dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich konnte gar nicht begreifen, was soeben geschehen war. Das Entsetzen stand in meinem Gesicht. Der Betrunken stürzte schließlich und ich wurde mit meinem Kind von hier fort gezogen, bis ich vor der Tür eines Hauses stand.
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!