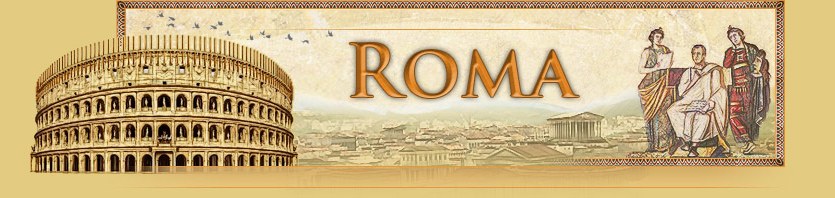Um ihn herum herrschte Markt, aber davon ließ sich Phaeneas nicht imponieren. Seit jeher hatte er es einwandfrei beherrscht, alles störende konsequent zu ignorieren, und so ließ er sich in aller Seelenruhe abseits an einer Hauswand nieder, die Beine angezogen, um darauf die Papyrusrolle zu positionieren, die er nun hervorholte, die die ‚Naturkunde‘ des älteren Plinius enthielt. Im Vergleich zu seinen Anfängen fand er die Stelle, an der er beim letzten Mal stehen geblieben war, inzwischen sehr schnell. Der Finger der rechten Hand vermerkte die ungefähre Stelle und der Bithynier vertiefte sich in den Text. Nachwievor las er sehr langsam, auch wenn er den Inhalt inzwischen zusammenhängend erfassen konnte, ohne ständig nachdenken zu müssen, was die mühevoll aneinandergelesenen Buchstaben und Silben denn eigentlich bedeuteten.
Der Anfang fügte sich noch gut in das ein, was Phaeneas vom Verfasser gewöhnt war:
Dass die Sonne der ganzen Welt Seele und, deutlicher, ihr Geist ist, dass sie die oberste Herrschaft der Natur und eine Gottheit ist, ist angebracht zu glauben, wenn man in Betracht zieht, was sie bewirkt. Sie nämlich bringt den Dingen das Licht und vertreibt die Finsternis, sie verbirgt und beleuchtet die übrigen Sterne, sie lenkt den Wechsel der Zeiten und das sich immer wieder erneuernde Jahr nach den Naturgesetzen, sie zerstreut am Himmel das Trübe und lässt auch die Wolken des menschlichen Geist- es sich aufhellen, sie leiht ihr Licht genauso den übrigen Sternen, hervorleuchtend, hervorragend, alles schauend, alles auch hörend, wie, soweit ich sehe, der erste Dichter, Homer, es nur an ihr so befunden hat.
Ich halte es deshalb für ein Zeichen menschlicher Schwäche, nach dem Bild und der Gestalt der Gottheit zu suchen. Wer auch Gott sein mag, wenn es überhaupt einen anderen gibt als die Sonne, und in welchem Teil des Alls er auch sein mag, er ist ganz Gefühl, ganz Gesicht, ganz Gehör, ganz Seele, ganz Geist, ganz er selbst. Unzählige Götter anzunehmen – und sogar entsprechend den Lastern der Menschen - , wie etwa eine Gottheit der Keuschheit, der Eintracht, des Geistes, der Hoffnung, der Ehre, der Milde, der Treue, oder, wie es Demokritos für richtig gehalten hat, nur zwei, Strafe und Belohnung, grenzt an noch größere Leicht- fertigkeit. Die gebrechlichen und geplagten Sterblichen haben, ihrer Schwäche bewusst, die Gottheit in Teile zerlegt, damit jeder in seinem Anteil das verehre, was er am meisten braucht.
Spätestens bei ‚Zeichen menschlicher Schwäche‘ prustete Phaeneas. Mit großen Augen verfolgte er weiter, was Plinius da behauptete. Dessen Beschreibung des Göttlichen konnte er mit seiner eigenen wagen Vorstellung davon prinzipiell nur zustimmen, bekam dann aber noch einmal große Augen bei der Art und Weise, wie der Autor über die ... allgemein verbreitete Perspektive von den Göttern herzog.
Aber ... es bestätigte Phaeneas‘ Sichtweise von der Lebenseinstellung seiner Zeitgenossen, die ihr Lebensglück viel zu sehr an einer ungewissen Gottheit aufzuhängen schienen. Gut, seiner eigenen Einschätzung nach gab es für ihn selbst sowieso kein Lebensglück; aber zumindest die Möglichkeit, gewisse Kleinigkeiten ein bisschen ins Bessere oder ins Schlechtere steuern zu können – gewissermaßen eigenhändig, ohne überirdisches Eingreifen. Erstrecht wenn es um die eigenen Tugenden und Laster ging. (Und gerade letzteres hatte der Bithynier perfekt im Griff, war seit Kindheit auf daran gewöhnt, jeden Wunsch danach, Spaß haben zu wollen, im Keim zu ersticken.)
Trotzdem war er von dem, was er da las, so überrumpelt, dass Phaeneas laut auflachte, überrascht und ein kleinwenig ungläubig, aber doch amüsiert, über diese seiner Meinung nach gewagte These.
Wer hat Lust, gemeinsam mit Phaeneas die Gedankengänge des Plinius zu den menschlichen Vorstellungen vom Göttlichen zu erkunden?
Inklusive Fortsetzung des Textes der Naturalis Historia