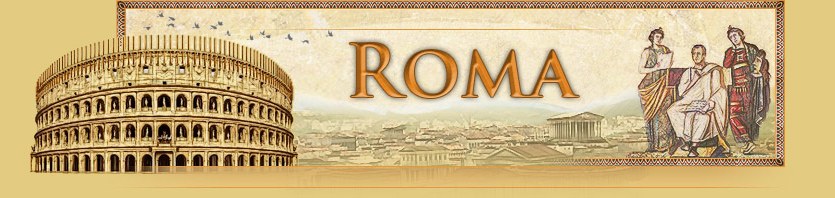Dies ist der Wohnsitz des Lucius Domitius Scordiscus in Rom.
Villa Domitia
-
-
Ein grandioses Fest. Oder das, was ihr herzallerliebster Gatte vielleicht dafür halten mochte. Und der Kaiser. Und alle anderen, die weder Geschmack noch Stil aufzuweisen hatten. An Geld konnte man irgendwie kommen, aber Geschmack hatte man – oder man hatte ihn nicht. Pompös war es gewesen, das schon, aber es war nicht das, was Nigrina sich unter einem wirklich grandiosen Fest vorstellte, dafür war es... zu... zu pompös. Zu protzig. Zu sehr zur Schau gestellt, ach wie toll Vescularius und seine Spezln alle waren und wie viel sie hatten und konnten und erreichten. Wie schon erwähnt: Geld konnte man irgendwie bekommen. Geschmack hatte man. Oder eben nicht.
Gut, in Nigrinas Welt war auch Geld etwas, was man einfach hatte.... aber es ließ sich natürlich vermehren, und sie hatte mit einiger Überraschung festgestellt, dass der Domitius gar nicht mal so arm war. Als sie dann gehört hatte, dass der Kerl von seinem Gönner als Quaestor in einer der reichsten Provinzen eingesetzt gewesen war, hatte sie das weniger gewundert, und zähneknirschend hatte sie sich zudem zumindest selbst eingestehen müssen, dass ihr zweiter Ehemann nicht ganz so stockdumm sein konnte, wie man es von einem Barbaren wie ihm eigentlich hätte erwarten müssen, wenn er es schaffte sich doch ein recht ansehnliches Vermögen anzuhäufen. Und, ja, gut, vielleicht hatte auch seine Familie ein bisschen was beigesteuert, die immerhin irgendwelche Fürsten in irgendeinem Barbarenkaff waren, wie sie gelernt hatte. Wie ihr Mann ihr recht eindrücklich klar gemacht hatte. Sie hatte ihn vor der Hochzeit nicht wirklich oft gesehen, nur die paar Mal, die nötig waren, um die Verlobung zu schließen und die Hochzeit zu besprechen, aber die paar Mal hatten gereicht, um ihr das ein oder andere klar werden zu lassen: er war nicht so schüchtern, wie ihr erstes Treffen sie hatte annehmen lassen. Er hatte wenig Skrupel. Und er konnte es nicht ausstehen, wenn sie über ihn oder seine Familie herzog.
Er mochte in der großen Runde, in Gegenwart des Kaisers zurückhaltend, fast schüchtern gewesen sein... aber das war er nicht. Oder vielleicht war auch nur ihre Gegenwart weit weniger einschüchternd als die des Vescularius. Oder er war einfach kein Großmaul. Alles drin. In jedem Fall war er lange nicht so zurückhaltend wie sie gedacht hatte, sondern im Gegenteil ziemlich... bestimmt. Und er hatte ihr sehr bestimmt klar gemacht, was er davon hielt, wenn sie abfällig wurde, ihm gegenüber oder sonst wem, der in etwa auf seiner Stufe stand – nämlich gar nichts. Genauso wie er klar gemacht hatte, was er von ihr erwartete, nämlich die brave Ehefrau zu spielen und sich mit allem zurückzuhalten, was ihm missfallen könnte... Das Problem war: sie wussten beide, dass sie keine Wahl hatte. Sie hatte niemanden, der sie schützen konnte, der eingreifen konnte. Ihre Familie war in alle Himmelsrichtungen verstreut, es war einfach niemand da. Nicht einmal jemand, der überhaupt etwas tun könnte, geschweige denn jemand, dessen Existenz allein schon genug Gewicht besaß, um die Sicherheit seiner Verwandten zu garantieren. Sonst wäre Nigrina ja gar nicht erst in diese missliche Lage gekommen, erneut heiraten zu müssen, und dann noch diesen Barbaren.Die Hochzeitsfeierlichkeiten waren entsprechend größtenteils seinen Vorstellungen gemäß organisiert worden – und Nigrina hatte sich darüber hinaus wenig Mühe gegeben, der Veranstaltung wenigstens ein bisschen ihr Siegel aufzudrücken. Wozu auch? Sie wollte diese Hochzeit ja gar nicht. Selbst wenn sie diesmal alles wesentlich freier hätte organisieren können – warum sollte sie sich anstrengen? Also hatte sie nicht einmal wirklich eigene Vorschläge gemacht, hatte nur aufgenommen, was er wollte... und danach alles an Sklaven weiter geschoben. Stattgefunden hatte die Hochzeit also in der Casa Domitia, schon allein deshalb, weil Nigrina ganz sicher nicht zugelassen hätte, dass die Villa Flavia durch so etwas beschmutzt wurde... Und jetzt, nach einer zumindest für sie eher durchwachsenen Hochzeitsnacht – wobei sie kaum Zweifel hatte, dass zumindest er auf seine Kosten gekommen war –, stand der Empfang am nächsten Tag an, zu dem sie noch einmal größer eingeladen hatten als zur Hochzeit selbst, wenn möglich. Und auf den sie auch keine Lust hatte... das einzige, womit sie zufrieden war, war ihr Aussehen, bei dem sich ihre Sklaven selbst übertroffen hatten: ihr Kleid ein Traum aus verschiedenen Schichten dünner Seide, die in den Blau- und Grüntönen des Meeres gehalten war; ihre Haare zuvor kunstvoll in eine Lockenpracht verwandelt, die sich nun wie ein Wasserfall über ihren Rücken ergoss, der jedoch sorgsam eingefasst war an ihrem Kopf, so dass keine Strähne nach vorne entweichen konnte außer jenen, die ihr Gesicht auch umrahmen sollten, und verziert war mit winzigen Nadeln, deren Köpfe mit kleinen Saphiren besetzt waren, die blau zwischen ihren Strähnen hervorblinkten; dazu ihr fein geschminktes Gesicht und zwei schmale, ebenfalls blaue Tropfen an ihren Ohren. Doch, mit ihrem Aussehen war sie zufrieden. Aber das war auch alles. Trotzdem würde sie für diesen Empfang ebenso wie für die Hochzeit die Zähne zusammenbeißen und gute Miene zum bösen Spiel machen. Was blieb ihr auch anderes übrig.
Sim-Off: Ich hoffe man verzeiht mir, dass ich diesmal darauf verzichtet habe, jedem eine gesonderte Einladung zu schicken. Allerdings gilt: jeder in Rom, der zur höheren Gesellschaftsschicht gehört, ist herzlich eingeladen – das gilt insbesondere für jene, die zu Salinators engerem Dunstkreis zählen, aber selbstverständlich auch für alle anderen

-
Potitus war eigentlich Abendgesellschaften gewohnt. Ein reichhaltiges Frühstück nach durchzechter Nacht war allerdings auch nicht schlecht! Also kam er relativ früh zum Hochzeitsempfang seines Klienten und der aufmüpfigen Flavierin. Er trug eine für seine Verhältnisse bescheidene helle Tunica unter der Purpurtoga und hatte sich lediglich fünf Ringe angesteckt, deren Gold gut zu seinem Lorbeerkranz passte. So ließ er sich, geleitet von seinen Skythen, ins Atrium geleiten.
"Scordiscus, altes Haus! Ich hoffe, du hattest eine schöne Hochzeitsnacht?" begrüßte er zuerst seinen Klienten, zwinkerte dabei aber Nigrina zu. Er erinnerte sich noch an ihr kleines Stelldichein, das nun schon einige Zeit zurücklag. Ob sein Günstling sie hatte zähmen können?
-
Es war spät. Sehr spät. Mitten in der Nacht, irgendwann – vielleicht sogar schon so spät, dass es bald schon wieder als sehr früh bezeichnet werden könnte, in jedem Fall aber jene Phase der Nacht, in der es am dunkelsten, am kältesten, am stillsten war. Trotzdem lag Nigrina wach, unfähig zu schlafen. Und genauso unfähig, aufzustehen und sich anderweitig zu beschäftigen. Weil sie nicht alleine war, weil heute eine dieser Nächte war, in denen ihr Mann geblieben, einfach neben ihr eingeschlafen war, und sie vermeiden wollte, dass er aufwachte. Sie wusste, wie er dann reagieren würde, es gab nur zwei Arten, die da möglich waren.
Wäre er nicht da, könnte sie also wenigstens aufstehen und etwas tun, anstatt einfach nur dazuliegen, in die Dunkelheit zu starren und darauf zu warten, dass sie endlich einschlief – andererseits: wäre er nicht da, hätte sie von vornherein keine Schwierigkeiten damit zu schlafen. Er war das Problem. Sie hasste es, wenn er blieb. Sie hasste ihn. Seine Art, seine Berührungen, seine Stimme, wie er sich bewegte und redete und verhielt, kurz, sie hasste einfach alles an ihm. Vor allem aber hasste sie, wie er sie behandelte. Sie war sich ziemlich sicher, dass die Abneigung auf Gegenseitigkeit beruhte – aber er war derjenige, der die Macht ausübte. Sie hatte keinen Verhandlungsspielraum, keine Position, in der sie irgendetwas für sich in die Waagschale hätte werfen können: keine Familie, deren Einfluss und Ruf sie schützte, keine sonstigen Fürsprecher, die mächtig genug waren, dass man es sich besser nicht mit ihnen verscherzte, indem man sich ihr gegenüber falsch verhielt. Sie hatte nicht einmal genug Vermögen, was ihr die ein oder andere Annehmlichkeit hätte erkaufen können. Zeit ihres Lebens war ihr Vater für sie aufgekommen, auch dann noch als sie schon verheiratet gewesen war, das erste Mal, hatte er sie weiter finanziell unterstützt, hatte dafür gesorgt, dass es ihr an nichts mangelte, an keinem Luxus, nach dem ihr gerade der Sinn stand. Jetzt besaß sie nicht einmal genug, um sich wenigstens ab und zu etwas Extravagantes leisten zu können, geschweige denn ihren Mann halbwegs im Zaum halten zu können. Oder besser: sie konnte nicht darauf zugreifen. Das Vermögen ihrer Familie war entweder beschlagnahmt oder ihrem Zugriff entzogen, und das, was auf ihren Namen lief, die Einnahmen aus der Pferdezucht beispielsweise, kontrollierte ihr Mann – und es spielte keine Rolle, ob das nun rechtens war oder nicht. Es gab niemanden, bei dem sie sich hätte beschweren können. Bei wem auch? Dem Vescularius oder einem seiner Lakaien? Sicher nicht. So tief würde sie nicht sinken, dass sie das tun würde, dass sie sich anmerken ließ, wie sehr sie das störte, wie sehr sie eingeschränkt war... selbst wenn dieser Emporkömmling, der sich nun Kaiser schimpfen durfte, seine Töle zurückgepfiffen hätte. Was sie aber ohnehin nicht glaubte.
Sie hasste dieses Leben, in das sie gezwungen worden war. Nicht nur, dass sie kaum Freiheiten hatte und weniger Luxus als früher, nicht nur, dass er alles kontrollierte, auch, dass sie schlicht und einfach an Einfluss verloren hatte hasste sie. Ihre Bekannten, Freundinnen... die, die noch da waren, die nicht geflohen waren oder selbst unter dem Regiment des neuen Kaisers litten, hatten sich von ihr abgewandt. Natürlich. Hätte sie auch nicht anders gemacht. Trotzdem hasste sie sie dafür. Erst recht, weil nichts, was sie versucht hatte in den letzten Wochen, um sich wieder ein wenig empor zu arbeiten in den weiblichen Gesellschaftskreisen, etwas gebracht hatte. Sie war verfemt, ausgestoßen, zwar geduldet in den Kreisen, wenn sie kam – aber Außenseiterin. Wäre ihr Mann wenigstens schon Senator, wäre es vielleicht ein bisschen besser... auch wenn es ein offenes Geheimnis war, wie mies diese erzwungene Ehe war, war sie doch mit ihm verheiratet, und ein höherer Status für ihn resultierte zwangsläufig auch in einem besseren für sie. Aber er war noch kein Senator. Und Nigrina fragte nicht, wann es so weit sein würde. Oder wie seine Planungen überhaupt aussahen.
Am meisten von allem hasste sie aber wahrscheinlich, was aus ihrem Leben geworden war, abseits von dem Mangel an Luxus, an Geld, an Einfluss und Macht. Sie empfand nur dann wirklich Ruhe, wenn er nicht im Haus war. War er da, reagierte sie unweigerlich darauf. Er musste nur nach Hause kommen, und sie spürte schon, wie ihr Puls anstieg, ihr Magen flatterte, ihre Beine weich wurden, ihre Ohren und Wangen leicht zu brennen anfingen, weil sich eine nervöse Anspannung in ihr breit machte. Er musste gar nichts tun. Er musste noch nicht einmal im selben Raum sein. Er musste nur im Haus sein, das genügte völlig, und sie stand unter Spannung. Anfangs hatte sie sich noch über sich selbst geärgert, wenn sie sich dabei ertappt hatte, wie sie vorsichtig geworden war, bemüht, leise zu sein, in der Hoffnung seine Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen. Mittlerweile war das so sehr zur Gewohnheit geworden, dass sie nur noch selten darüber nachdachte, geschweige denn sich ärgerte über sich. Es gab durchaus Tage, an denen alles wie normal schien, ihre Gespräche, ihrer beider Verhalten. Aber es gab eben auch die Tage, an denen sie ihm nichts recht machen konnte. An denen er nur Dinge auszusetzen hatte an ihr, was er ihr dann auch regelmäßig kundtat, mal scharf, mal laut, aber immer irgendwie unangenehm – vor allem, weil sie nichts kontern konnte. Auch das hatte sie anfangs noch getan, schon allein aus Prinzip, sie konterte immer irgendwie. Aber Widerspruch machte es nur schlimmer, und auch hier war sie irgendwann an den Punkt gekommen, an dem sie... aufgab. Sie zog einfach immer den Kürzeren. Er ließ sie nicht gehen, hörte nicht auf, bis er den Eindruck hatte, dass sie eingesehen hatte, dass sie unterlegen war, und er wurde auch gerne mal handgreiflich dabei, gerade wenn sie widersprach und sich weigerte, sich demütigen zu lassen. Er wusste genauso gut wie sie, dass sie keine andere Wahl hatte als zu bleiben. Er wusste genauso gut wie sie, dass es keine Familie, keine Freunde gab, in deren Arme sie flüchten könnte... und dass der Kaiser auf seiner Seite war. Immerhin hatte der sie ja verschachert. Und er nutzte das aus.Sie lag da und starrte in die Dunkelheit, während sie den Atemzügen neben sich lauschte. Die Nächte waren noch mal eine Sache für sich. Unterschiedlich, je nach seiner Stimmung. Es war nicht immer schlecht, nur... sie wollte gar keinen Spaß mit ihm haben. Sie verabscheute ihn zu sehr, um das zu wollen. Und in den Nächten, in denen es irgendwie doch dazu kam, weil er gut gelaunt war und auf sie einging, weil sie sich nach Berührung und Lust sehnte und sich nicht gut genug unter Kontrolle hatte, ekelte sie sich danach vor sich selbst. Und dann gab es freilich noch die Nächte, in denen er schlecht gelaunt war – auch da fiel es ihr schwer, beherrscht zu bleiben, keine Reaktion zu zeigen, weil es zu unangenehm war. Meistens allerdings gelang es ihr ganz gut, ihn einfach machen zu lassen, ohne dass sie sonderlich beteiligt war. Sie kapselte sich ab und ließ ihre Gedanken schweifen, bis er fertig war, das war der Usus, betrachtete man ihre Bettaktivitäten. Heute aber war so eine Nacht, in der er gut gelaunt gewesen war – die Garde war dabei auszurücken, um den Truppen im Norden gegen die Rebellen zu helfen, und er war felsenfest überzeugt, dass sie bald siegreich nach Hause kommen würden. Gut gelaunt war er also gewesen, und überraschend aufmerksam ihr gegenüber, und sie, sie hatte nicht anders gekonnt als darauf zu reagieren, hatte sich zu sehr geöffnet, hatte es genossen... Vielleicht war das der Grund, warum sie es nicht ertrug, nun einzuschlafen, mit ihm an ihrer Seite. Sie hasste sich selbst, sie hasste seine Nähe, und sie ekelte sich vor dem Gedanken, am nächsten Morgen womöglich an ihn geschmiegt aufzuwachen. Sie wollte nicht mehr. Sie hatte schon öfter den Gedanken gehabt, dass sie das nicht mehr lange ertragen würde, dass sie nicht mehr wollte, nicht mehr konnte, aber noch nie war er so drängend gewesen wie in diesem Moment: sie wollte einfach nicht mehr. Das war nicht sie. Dieses Leben, die Demütigungen, die Unterdrückung, und sich das alles einfach gefallen lassen zu müssen, keine Möglichkeit, keine Handhabe sich wirklich dagegen zu wehren, das alles war einfach nicht sie.
-
Nigrina tat in dieser Nacht kein Auge zu. Sie lag wach bis zum Morgengrauen, und als ihr Mann aufwachte und sie noch mal nahm, lag sie dieses Mal wie üblich einfach nur da und ließ es geschehen, anders als noch am Abend zuvor. Dass sich etwas geändert hatte, merkte er nicht – nicht während er sich noch mit ihr beschäftigte, nicht als er danach noch bei ihr lag für einige Zeit, nicht als er schließlich ging und sie allein ließ. Für ihn war alles wie immer. Für sie hatte sich alles geändert. Worüber sie schon seit Wochen nachdachte, im Ansatz sogar schon plante, jetzt war der Moment, in dem sie beschlossen hatte, dass sie es umsetzen würde: sie würde verschwinden. Wenn sie es jetzt nicht tat, würde sie kaum noch eine Chance dazu haben, mit dem Krieg vor der Haustür. Jetzt gab es noch Möglichkeiten, verhältnismäßig gute sogar: die Garde würde bald ausrücken, die Urbaner wären alleine in Rom. Ausgangssperre gab es ohnehin nicht mehr. Sicher bestand die Möglichkeit, dass Vescularius verlor, und Nigrina hoffte und betete inbrünstig, dass genau das passierte. Aber wenn Vescularius gewinnen sollte, dann war damit vielleicht ihre einzige Chance dahin, aus dieser elenden Ehe zu fliehen. Nein, falls der Kerl gewann, wollte sie weg sein aus Rom, und irgendwo, in irgendeinem angenehmen Exil ihr Leben verbringen, mit ihrem Vater, ihrer Familie, und es würde umso schwerer zu erreichen sein, wenn der Krieg erst mal für Vescularius gewonnen war. Es würde jetzt schon schwer genug sein, wobei es immer noch Orte gab, wo Verwandte waren... Baiae, beispielsweise. Sie wusste, dass in Baiae immer noch jemand war, vielleicht nicht unbedingt auf den flavischen Gütern, aber in dort irgendwo, bei Menschen, die ihnen treu ergeben waren. Tante Agrippina war sicher noch dort, Nigrina konnte sich nicht vorstellen, dass sie Baiae verlassen hatte. Vielleicht sogar ihr Vater, wer wusste das schon. Und falls Vescularius doch verlor... würde sie immer noch zurück kehren können. Wenn Gras über die Sache gewachsen war, diese unangenehme Sache, die sich da ihre aktuelle Ehe nannte. Sie würde das nicht ungeschehen machen können, das wusste sie, dieser Makel würde immer irgendwie an ihr haften. Verheiratet mit einem Plebejer. Einem Barbaren. In einem Rom unter Cornelius würde ihr Status zumindest zunächst mal nicht wesentlich höher sein als jetzt... es konnte also vielleicht nicht schaden, wenn dann etwas Zeit verging. Aber das war eine Entscheidung, die sie ihrem Vater überlassen würde, vorausgesetzt sie schaffte es, ihn zu finden.
Es war gar nicht mal so schwer, das, was sie ohnehin schon geplant hatte, nun auch in die Tat umzusetzen. Es dauerte ein paar Tage, bis alles vorbereitet war... Tage, in denen sie versuchte sich zu geben wie immer, damit ihr Mann keinen Verdacht schöpfte, was ihr allem Anschein nach auch gelang. Es war auch nicht allzu schwer – unter einer gewissen Anspannung stand sie in seiner Gegenwart ja ohnehin. Sie weihte nur wenige ein, wenige, von deren Loyalität sie absolut überzeugt war. Sie beauftragte einen von ihnen, das Land zu verkaufen, das auf ihren Namen eingetragen war, um an Geld zu kommen, das sie so dringend brauchte, und das sie momentan in so – für das, was sie gewohnt war – geringem Maß nur zur Verfügung hatte. Der flavische Klient erzählte ihr etwas davon, dass er es über einen Mittelsmann an die Auctrix verkauft hätte, aber das interessierte sie schon gar nicht mehr. Wichtig war nur: sie hatte Geld. Geld, mit dem sie nun weiteres organisieren konnte: einen Transport aus der Stadt. Einen Schutztrupp, der sie begleiten würde. Sie verdrängte jeden Gedanken daran, was beim letzten Mal passiert war, entschied sich aber zähneknirschend dazu, dass sie dieses Mal reiten würde. Nicht selbst, das konnte sie gar nicht, sie hatte noch nie auf einem Gaul gesessen, aber gemeinsam mit ihrem Leibwächter. Sie wollte schnell fortkommen, und es gab dieses Mal keine Schwangerschaft, die ein unbestreitbarer Hinderungsgrund war – aber selbst wenn es eine gegeben hätte, wäre es kein wirklicher Grund gewesen, legte sie doch ganz sicher keinen Wert darauf, ein Balg von ihrem jetzigen Mann lebend zur Welt zu bringen. Und nachdem das alles organisiert war, blieb noch eines zu tun. Eine Sache, bevor sie gehen konnte. Scordiscus. Auch darüber hatte sie sich Gedanken gemacht, mehr und ausgiebiger sogar als für alles andere. Nicht, weil sie nachdenken musste, was sie tun wollte – sondern weil sie sich überlegen musste, wie sie es tun wollte. Und weil sie es sich gern ausmalte. Am Abend ihrer Flucht brachte sie ins Rollen, was als einzig logische Variante schien. Sie hatte Gift besorgt. Eisenhut, hatte ihr der Sklave gesagt, aber auch das war ihr egal. Wichtig war nur: es war ein starkes Gift. Ein schnelles. Und mehr als alles andere: ein schmerzhaftes. Sie hatte ja durchaus mit dem Gedanken gespielt, ihn eigenhändig zu töten, aber sie wollte auch, dass er litt, und sie wusste, dass sie nicht stark genug war, um ohne Hilfsmittel dafür zu sorgen. Sie war ihm körperlich unterlegen, daran führte nichts vorbei. Und da sie niemanden sonst dabei haben wollte, wenn ihr Mann in die Unterwelt wechselte, blieb wohl nur Gift übrig... was auch noch den weiteren Vorteil hatte, dass am nächsten Morgen kaum noch sichtbare Spuren da sein würden, die darauf hinwiesen, woran er gestorben war. Er konnte auch krank gewesen sein, oder plötzliche Schwierigkeiten bekommen mit irgendwelchen Innereien. So was passierte, Menschen starben die ganze Zeit, und nur für den Fall, dass sie irgendwann nach Rom zurückkehren konnte und ihr das irgendjemand ankreiden wollte: dann war es schlicht und ergreifend besser, wenn er nicht eines offensichtlich unnatürlichen Todes gestorben war. Kein Messer durch die Kehle, so gern sie das auch getan hätte, oder es sich zumindest vorstellte.
Gift also war es, das Scordiscus' Ende brachte. Sie zogen sich zurück, an jenem Abend, er begleitete sie, wie so häufig... aber der schwere, süße Wein, den er in ihrem Cubiculum trank, überdeckte den zuerst ebenfalls süßlichen Geschmack des Gifts. Er kam zu ihr, nachdem er seinen Kelch zur Hälfte geleert hatte, und küsste sie, wollte sie küssen, aber sie konnte gerade noch den Kopf zur Seite drehen, und seine Lippen trafen ihren Hals. Irrte sie sich, oder spürte sie ein merkwürdiges Kribbeln auf ihrer Haut, dort, wo seine Lippen, noch feucht vom Wein, sie berührten? Sie war sich nicht sicher. Trotzdem löste sie sich von ihm, verzog nur ihre Mundwinkel zu einem belanglosen Lächeln und griff nach ihrem eigenen Weinbecher, den sie wohlweislich aus dem Triclinium mitgebracht hatte. Stellte ihm ein paar Fragen, so belanglos wie ihr Lächeln, aber er ließ sich darauf ein, antwortete... und trank ebenfalls erneut. Sie unterhielten sich weiter, nicht sonderlich lang, weil er nicht auf ein Gespräch aus war... aber das Gift brauchte auch nicht lang, um zu wirken. Noch während er erneut zu ihr kam, hielt er plötzlich inne, reagierte nicht auf eine unschuldige Nachfrage von ihr, was denn los sei, sondern befühlte nur seine Lippen. Besah sich seine Finger. Runzelte die Stirn, und sagte dann nur, dass er sich plötzlich nicht gut fühlte. Nigrina bot ihm an, sich auf ihr Bett zu setzen, was er auch tat, vielleicht noch einen Schluck Wein zu trinken – was er ebenso tat. Allerdings nur einen. Während seine Haut vor Schweiß zu glänzen begann und er sich mit einer Hand an den Bauch fasste, sah er auf, und in diesem Moment konnte Nigrina das Erkennen in seinen Augen aufblitzen. Aber da war es schon zu spät. Fassungslos starrte er sie an, dann wurde er schon vom ersten Krampf geschüttelt, der seinen Magen erfasste. Er sank zurück auf das Bett, rief nach jemandem, aber dafür hatte Nigrina gesorgt, dass kein Sklave in der Nähe war, der nicht loyal zu ihr war. Sie schenkte ihm ein Lächeln, ein letztes, und ignorierte die Tiraden, die er nun gegen sie losließ. Er schimpfte, er fluchte, er bettelte, aber sie reagierte gar nicht, sagte nichts darauf, sondern betrachtete ihn nur schweigend. Sie hatte sich in einen Sessel sinken lassen, nippte an ihrem Wein und beobachtete mit einer Mischung aus Genugtuung und Faszination, wie es mit ihm zu Ende ging. Wie er von Krämpfen geschüttelt wurde. Wie er sein Abendessen los wurde, sowohl oben als auch unten – an dieser Stelle spürte sie auch Ekel, aber die Genugtuung war eindeutig stärker. Zu betrachten, wie er sich wand vor Schmerzen, das war es, was sie sehen wollte, und sie sah es... sah alles, bis er schließlich still war. Es vergingen noch einige weitere Momente, in denen sie einfach da saß und ihren nun toten Mann musterte. Dann erhob sie sich mit einem Ruck, und ohne einen Blick zurückzuwerfen, verschwand sie – aus dem Raum, aus dem Haus, und schließlich aus der Stadt. -
http://img261.imageshack.us/img261/6518/raghnall.png Raghnall hatte sich selbstredend erst um den Teil des Auftrags des Flavius gekümmert, der ihn auch selbst interessierte: was war mit seiner Herrin und deren Bruder. Nachdem das allerdings erledigt war, hatte er begonnen sich auch um den anderen Teil zu kümmern: sich umzuhören, was wohl mit den verbliebenen Flaviern war. Flavius Furianus war, das war nicht schwer herauszufinden gewesen, verbannt worden und tummelte sich irgendwo im Exil. Bei anderen war das schon schwieriger, zumal der Flavier deutlich gesagt hatte, er solle nicht zu explizit fragen. Informationen über die engste Familie des Flavius Gracchus wären für Raghnall aber wohl sowieso nicht aufzutreiben gewesen, vermutete er, davon schien keiner auch nur irgendetwas zu wissen... außer, dass sie irgendwann einfach verschwunden waren, so wie Flavius Gracchus selbst verschwunden war. Die flavischen Landgüter dagegen waren durchaus Gegenstand vieler Gerüchte – aber es waren eben nur das: Gerüchte. Und je nachdem waren sie wahlweise ganz zerstört, einfach nur geplündert oder sogar unangetastet davon gekommen. Nur was die Besitzungen in Baiae betraf, wo der Einfluss der Flavier scheinbar recht groß war, stimmten die Gerüchte größtenteils überein, dass sie keinen Schaden davon getragen hatten – genauso wie jene auf Sizilien, wo der bei den Sklaven berüchtigte Flavius Felix hauste.
Blieb noch ein weiteres Familienmitglied, das in Rom gelebt hatte und ebenso verschwunden war: Flavia Nigrina. Und bei ihr hatte Raghnall allerdings immerhin etwas mehr Erfolg. Ein paar Fakten waren recht leicht herauszufinden gewesen: dass sie wohl Rom hatte verlassen wollen, dass sie erwischt und vom Vescularius gezwungen worden war, sich scheiden zu lassen und einen seiner Getreuen zu heiraten. Der mittlerweile auch tot war, und die Flavia – verschwunden. Raghnall beobachtete das Haus ein paar Tage lang, versuchte ein paar Informationen über die Sklaven zu bekommen, aber letztlich stellte sich heraus, dass das kaum nötig gewesen wäre: die Sklaven waren allesamt recht orientierungslos und langweilig ohne Herrschaften, vertrieben sich die Zeit damit, das Haus in Schuss zu halten und sonst nicht viel zu tun außer darauf zu warten, dass jemand zurückkam, und es wäre wohl egal gewesen, wen er sich am Ende herausgepickt hätte. So oder so: mit spendiertem Wein und ein paar zusätzlichen Münzen war der Mund des Sklaven, den er sich schließlich vornahm, locker genug, dass Raghnall nicht einmal wirklich fragen musste, und er erzählte schon alles mögliche, was er wusste. Und was er meinte zu wissen. Und was er gehört hatte. Und so. Nicht alles davon war brauchbar, aber trotzdem hatte Raghnall mehr erfahren, als er davor gehofft hätte. Zwangsheirat, ja; keine sonderlich schöne Ehe; keine sonderlich nette Domina, weswegen die Sklaven ihr durchaus gönnten, wie ihr Mann mit ihr umsprang; eine Domina, die in aller Regel nur Sklaven direkt um sich duldete, denen sie absolut trauen konnte. Und vor allem anderen, was in der Nacht passiert war, in der der Hausherr gestorben war, abseits von allem Tratsch und den Gerüchten, die der Sklave zu verbreiten wusste: dass sich die Herrschaften an jenem Abend in das Cubiculum der Flavia zurückgezogen hatten; dass dort nur Sklaven in der Nähe gewesen waren, die ihr treu ergeben waren; dass am nächsten Morgen keine Spur von der Flavia zu finden gewesen war, und auch nicht von ihren Sklaven... und dass der Hausherr, ein Mann in den besten Jahren und vorgeblich bei bester Gesundheit, tot in ihrem Cubiculum gefunden worden war.
Passiert war danach scheinbar wenig. Der Mann war bestattet worden, aber mit dem Bürgerkrieg vor der Tür hatte sich keiner mehr wirklich um das Verschwinden der Flavia gekümmert – und als die Nachricht gekommen war, dass Legionen auf Rom marschierten, so der Sklave, seien die Verwandten des Dominus geflüchtet. Und seitdem würden sie hier warten... war ja nicht das schlechteste Leben so. Raghnall trank noch ein bisschen mit dem Kerl, dann verabschiedete er sich und machte sich auf den Weg zurück zum Flavius.

SKLAVE - DECIMA SEIANA
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!