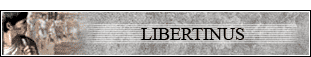Die Veränderung. Die mit dem jungen Herrn vonstatten geht. Sie ist eklatant.
Der Tatendrang. Die Zuversicht. Die Lycidas bezauberten. Sie weichen der Mutlosigkeit. Angst!
Angst, die sogleich auf Lycidas übergreift. Erst die Augen. Hernach der Körper. Der jungen Herr wendet sich ab. Möchte er Lycidas nicht in die Augen sehen, wenn er ihn fortschickt?
Die erste Option. Lycidas wird leichenblass. Sabefs Kreuzestod. Die Hand des Claudiers. Wieder spürt er sie in seinem Nacken. "Sieh hin!" Es dröhnt in seinen Ohren. Lycidas sinkt tiefer in seinen Sitz. Es wäre schön, dem jungen Herrn zu gehören. Vielleicht... würde der Claudier sogar zustimmen? Ein Fürsprecher, so wortgewandt und edel von Angesicht könnte ihn großmütig stimmen. Könnte. Oder auch nicht. Eher nicht, glaubt Lycidas.
Die zweite Option. Sie klingt ausgesprochen abenteuerlich! Flucht. Maskerade. Schimpf und Schande. Lycidas mag keine Abenteuer. Die Reise ins Innere des schwarzen Kontinentes - sie war grauenvoll. Seine Flucht - entsetzlich. Noch mehr Abenteuer dieser Art kann er nicht überstehen. Ständig auf der Flucht zu sein - Lycidas ist sich sicher, vor Furcht zu sterben, noch bevor die Häscher des Claudiers ihn erreichen. Er ist ein zarter Sklave. Er benötigt ein harmonisches Umfeld. Einen ruhigen Hafen. Wie diese schöne Villa. Hier fühlt er sich wohl.
Und auch für den jungen Herrn ist das Risiko bei weitem zu groß. Nur sehr selten kommt es vor, dass Lycidas am Schicksal eines anderen Anteil nimmt. Die Menschen sind ihm fern. Unvertraut. Er ist nicht einsam. Er hat die Musik. Doch die Menschen... unberechenbare Halbgötter die Claudier. Neider und Rivalen die anderen Sklaven auf der Insel. Die übrigen... fremd. Seeanemonen. Manchmal Publikum. Und manchmal hasst Lycidas sie. Die Sprechenden. Alle.
Aber nicht den jungen Herrn. Etwas merkwürdiges ist geschehen. Lycidas möchte nicht, dass Aristoxenus sich in Gefahr begibt. Wegen ihm. Mit einem Mal fürchtet er nicht nur um sich. Sanftes Erstaunen umwölkt Lycidas' Brauen.
Cleonymus. Schwarzbart! Der Herr des Gasthauses. Ein führender Kopf der Polis?! Allerdings zeigte er sich zuvorkommend. Viel zu zuvorkommend! Aristoxenus' Worte bergen eine Erklärung für dieses unheimliche Verhalten. Ein Zierobjekt sein. Damit hat Lycidas viel Erfahrung. Es klingt äusserst verlockend. Doch was hinter der Fassade liegt. Er kann es nicht wissen. Das wahre Gesicht der Herrschaften. Oftmals zeigen sie es erst, wenn man in ihrem Besitz ist.
Lycidas schlägt die Augen nieder vor dem dringlichen Blick seines Retters. Zögert. Aber nicht lange. Das Wasser steht ihm bis zum Hals. Vielleicht ist Schwarzbart die Rettung. Lycidas muss versuchen, mit der Lyra seine Gunst zu erringen. Und Aristoxenus soll nicht noch weiter mit hineingezogen werden.
Blass die Finger, die den Stylus umgreifen. Mit dem abgeflachten Ende streicht Lycidas seine Sätze aus. Zu blasphemisch um sie stehen zu lassen. Dann dreht er den Stylus. Schreibt:
Ich werde zu ihm gehen. Dem Herrn des Kapeleion.
Ich danke Dir für Deinen Rat, verehrter Kyrios. Für alles.
Kommst Du mit? Kann ich noch ein wenig bei Dir bleiben? So ich überlebe, darf ich Dich dann besuchen? Diese Fragen brennen Lycidas auf der Seele. Doch sie wären ganz und gar unangemessen.
![]()
![]()