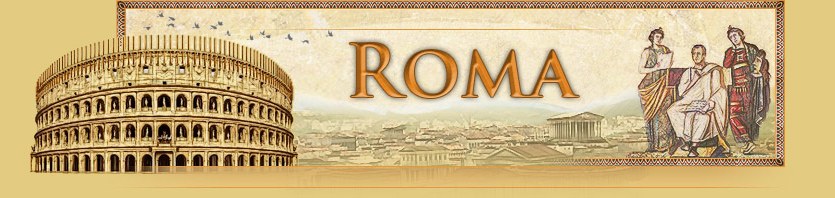Seiana zog angedeutet eine Augenbraue hoch, als sie die poetische Antwort von Xanthias hörte. Sie war sich nicht ganz sicher, ob er das nun tatsächlich ernst meinte – und nur etwas übertrieben formulierte – oder ob er sich nicht doch lustig machte, weil er Sklave war. Sie musterte ihn einen Augenblick schweigend, dafür aber umso intensiver, während ihr Gesicht unbewegt blieb. So oder so lieferte er damit den nächsten Beweis dafür, wie gebildet er war. Den Auftrag, den sie hatte, würde ihn ganz sicher unterfordern. Aber es ging auch nicht darum, ihn zu fordern, es ging darum, ihn und Aristea zu testen. Herauszufinden, wie sehr sie ihnen vertrauen konnte. Es wäre eine Verschwendung, könnte sie Xanthias nicht seinen Fähigkeiten gemäß einsetzen, weil sie ihm nicht vertraute, aber weit schlimmer wäre es, wenn sie ihm zu schnell traute – und er es dann ausnutzte.
„Das freut mich“, antwortete sie dann nur knapp, ohne ihre Gedanken zu formulieren, als gleich darauf Aristea eintrat. Seiana begann also zu erklären, welchen Auftrag sie hatte, und nachdem Xanthias keine Fragen hatte und Aristea sich recht schweigsam gab, auch nicht den Anschein machte, als hätte sie irgendeine Frage, nickte Seiana. „In Ordnung. Dann erledigt das jetzt, und danach möchte ich, dass ihr zu mir kommt und mir Bericht erstattet.“